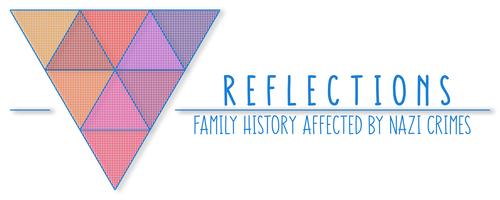Wie beeinflusst die Familiengeschichte das eigene Leben?
Am Wochenende vom 16. Januar/ 17.Januar 2017 kamen die Teilnehmer_innen des Filmprojekts für junge Erwachsene „Welcher Films spielt denn hier? Macht (eure) Geschichte zum Film“, das von der Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI)und dem Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte Neuengamme e.V. gefördert wird, zum zweiten Mal in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme zusammen. Bis Anfang Mai 2016 werden die jungen Erwachsenen im Alter von 15-22 Jahren noch zwei weitere Wochenenden zusammen verbringen, um ihre eigene Familiengeschichte zu recherchieren, Wünsche für ein zukünftiges Erinnern zu formulieren und hierüber einen Stop-Motion-Film zu drehen. Der Film wird auf der Gedenkfeier der KZ-Gedenkstätte Neuengamme anlässlich des 71. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung der Konzentrationslager am 3. Mai 2016 der Öffentlichkeit präsentiert.
Zentrale Themen des zweiten Seminarwochenendes waren die verschiedene Formen der Erinnerung und des Gedenkens, sowohl in den Familien als auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Neben einem tieferen Einstieg in die Recherche der Familiengeschichten ging es auch um Orte und Formen des Gedenkens sowohl in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme als auch in verschiedenen Stadtteilen Hamburgs.
Was hat meine Familie während der Zeit des Nationalsozialismus gemacht?
Die Teilnehmer_innen des Projekts hatten sich an diesem Wochenende viel zu erzählen. Die Zeit seit dem vergangenem Seminarwochenende im November hatten alle genutzt, um weiterführende Recherchen über ihre Familiengeschichte anzustellen, Gespräche mit Eltern und Großeltern zu führen und Dokumente und Fotos auf Dachböden zu entdecken.

Teilnehmer_innen teilen ihre Rechercheergebnisse miteinander. © KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2016.
Den Einstieg in dieses Seminarwochenende bildete somit der Austausch in sogenannten „Murmelgruppen“, zu dritt oder viert setzten die Teilnehmer_innen sich zusammen, erzählten sich von neuen Erkenntnissen, tauschten sich über Vorgehensweisen, Hindernisse und den Umgang hiermit aus. Hatten die Teilnehmer_innen sich über den Jahreswechsel noch dem jeweiligen Umgang ihrer Familien alleine stellen müssen, war hiermit ein Rahmen gegeben, sich über die Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.
Zwei Teilnehmerinnen haben in kurzen Videos Ihre Vorgehensweise, Erkenntnisse und Emotionen bei der Recherche in Videos festgehalten:
Familiengeschichte – Privatsache oder ein Thema für die Öffentlichkeit?
Spannend war hierbei vor allem die Diskussion über Tabus, Familiengeheimnisse, unangenehme Wahrheiten und die Frage, ob solche veröffentlicht werden können oder im Familienkreis bleiben sollten. Veröffentlichungen, z.B. Niklas Franks (2005) „Eine Abrechnung“, Alexandra Senfts (2008) „Schweigen tut weh“ sowie die Artikel von Tom Devos und Barbara Brix auf diesem Blog, gaben den Teilnehmer_innen Beispiele dafür, wie unterschiedlich Menschen mit dieser Frage umgehen.
Einen Höhepunkt bildete in dieser Auseinandersetzung das Gespräch mit Barbara Brix vom Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte Neuengamme e.V.. Nach dem gemeinsamen Mittagessen berichtete sie von ihrer jahrelangen Recherche über ihren Vater und seine Beteiligung an der Einsatzgruppe C, die in der Ukraine Massenerschießungen durchgeführt hatte. Sie ließ die Teilnehmer_innen teilhaben an ihrem komplexen Weg der eigenen Auseinandersetzung mit den historischen Tatsachen sowie ihrem emotionalen und persönlichen Umgang hiermit. Dabei erzählte sie auch von Phasen der intensiven Beschäftigung und Phasen der Distanzierung. Die Offenheit mit der Barbara Brix über ihre Recherche berichtete und die Bereitwilligkeit, auch selbstkritisch auf die vielen Fragen der Teilnehmer_innen einzugehen, beeindruckte alle.

Barbara Brix berichtet von ihrem Umgang mit der Geschichte ihres Vaters. © KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2016
Nach dem Barbara Brix sich verabschiedet hatte diskutierten die Teilnehmer_innen hitzig weiter über die Frage, ob Familiengeschichte wirklich nur etwas Privates sei oder sie gar an die Öffentlichkeit gehöre. Zu einem Konsens kamen die Teilnehmer_innen nicht, konnten aber die Argumente der anderen nachvollziehen.
Das Storyboard – erste Gedanken zu Szenen und Umsetzung der Stop-Motion-Filme
Aber auch die Arbeit an den eigenen Filmen kam an diesem Wochenende nicht zu kurz. Nach einer Einführung in die Aufgabe von Drehbuch und Storyboard bei der Erstellung eines Films analysierten die Teilnehmer_innen zwei sehr unterschiedliche Filme über Familiengeschichte (Swantje Wenz‘ „Family Portrait“ und Guy Königsteins „Family Stories“). Anschließend machten sie sich an erste Storyboard-Skizzen für ihre eigenen Filme. Das konkrete Arbeiten an den Filmen nahm den Teilnehmer_innen die Anspannung, das Gefühl zu haben, nicht zu wissen, wie sie ihre Familiengeschichte und den Einfluss dieser auf eigenes Leben darstellen sollten. Klar wurde allen, dass es nicht um eine Nacherzählung der Familiengeschichte geht, sondern um ihr eigenes Denken und Handeln.

Die Filmprojekt-Gruppe beim Brainstorming zum Thema „Storyboards“. © KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2016.
Begeistert waren die Teilnehmer_innen davon, dass Stop-Motion-Filme zahlreiche Möglichkeiten bei der Umsetzung von Ideen bieten. Es kann z.B. gezeichnet, geknetet oder gebastelt werden, aber auch am Computer designed oder händisch zusammengeklebt werden oder gar Alltagsobjekte zweckentfremdet werden.
Erinnern und Gedenken – aber wie?
Zwar stand der Umgang mit der eigenen Familiengeschichte im Vordergrund dieses Seminarwochenendes, dennoch verwendeten die Teilnehmer_innen auch viel Zeit darauf, sich mit Formen des gegenwärtigen Erinnerns, dessen Wirkung auf sie selbst und seine Rolle für die Gesellschaft zu beschäftigen. Beim Rundgang über das Gelände der KZ-Gedenkstätte Neuengamme besuchte die Gruppe vornehmlich Orte, die zum Trauern und Gedenken genutzt werden. Immer wieder kehrten die Gespräche zurück zu den verschieden Ansprüchen an die Gedenkstätte, als (Ersatz-)Friedhof, als Lernort und als Ort offiziellen Gedenkens. Dass nicht immer alle Erwartungen erfüllt werden können, insbesondere was die Gestaltung des Geländes betrifft, wurde dabei auf eindrucksvolle Art deutlich.

Teilnehmerin im Haus des Gedenkens. © KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2016.
Da die KZ-Gedenkstätte Neuengamme aber nicht der einzige Ort ist, an dem in Hamburg an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert wird, gingen die Teilnehmer_innen in kleinen Gruppen auf Erkundungstour im Hamburger Zentrum.
Eine Gruppe bewegte sich rund um den Bahnhof Dammtor. Sie startete am sogenannten „Kriegsklotz“, dem 1936 eingeweihten Kriegerdenkmal, inspizierte selbstverständlich auch das Gegendenkmal von Alred Hrdlika und das neue Deserteursdenkmal. Anschließend verbrachten sie viel Zeit am Denkmal „Der letzte Abschied“, das an die Kindertransporte erinnert. Die Gruppe war besonders schockiert über die Mengen an Müll vor dem Denkmal, die offensichtlich noch aus der Silvesternacht stammten. Hier kamen sie auch ins Gespräch mit Passanten, die sich ebenfalls das Denkmal anschauten.
Zum Abschluss begaben sie sich zum Mahnmal „hier und jetzt“ für die Opfer der NS-Justiz am Sievekingplatz, das ihnen besonders gut auf Grund seiner „Andersartigkeit“ gefiel. Die Gruppe fragte sich aber auch, wie vielen Passanten überhaupt noch bewusst ist, an wen mit der Installation erinnert wird.
Die zweite Gruppe begutachtete die Erinnerungslandschaft im Stadtteil Eppendorf. Das Mahnmal „Verhörzelle“ beispielsweise erinnert an die Widerstandskämpfer_innen der Weißen Rose. Etwas weiter stieß die Gruppe auf zwei eher zusammenhangslos wirkende Gedenktafeln für den Schriftsteller Wolfgang Borchert, und mehrere Benennungen von Straßen und einer Schule nach Verfolgten des Nazi-Regimes. Diese Gruppe war besonders schockiert davon, dass die Erinnerungsorte im Straßenbild „untergehen“ zu scheinen, weil sie so unauffällig sind bzw. an Orten aufgestellt wurden, an denen kaum ein Passant vorbeikommt.
Beide Gruppen hatten die besuchten Orte mit Fotos dokumentiert. Mit Hilfe dieser Aufnahmen konnten sie – zurück in der Gedenkstätte – einander ihre Eindrücke vermitteln. Die Unterschiedlichkeit der Gedenkorte- und Formen vor allem in ihrem jeweiligen zeitlichen Entstehungskontext wurde sehr deutlich und bot einen spannenden Einblick in die Veränderung der Erinnerungskultur im Laufe der Zeit.
Einige der besuchten Gedenkorte waren vom Zerfall gezeichnet, verrostet, inhaltlich nicht mehr zeitgemäß, von Laub überdeckt und von Passant_innen weitestgehend ignoriert. Wie Erinnern und Gedenken lebendig gehalten werden kann und nicht verstaubt, diese Frage nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun gedanklich mit in die Zwischenzeit bis zum nächsten Seminarwochenende Ende Februar. Denn dann geht es an die Erarbeitung der individuellen Stop-Motion-Filme!