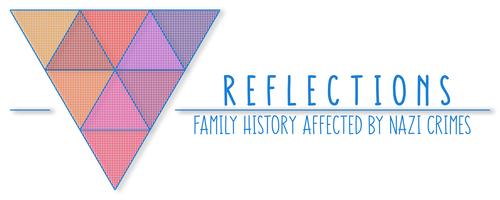Einander kennenlernen – trotz alledem
Am 4. und 5. März 2016 bietet die KZ-Gedenkstätte Neuengamme Nachkommen von Verfolgten des Nationalsozialismus und Nachkommen von NS-Täter_innen die Möglichkeit, im Rahmen des Workshops Dialogseminar 4. und 5. März 2016 in einen zukunftsgerichteten Austausch miteinander zu treten. Dr. Oliver von Wrochem (OvW), Leiter des Studienzentrums der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, sprach mit Swenja Granzow-Rauwald (SGR) und Ulrich Gantz (UG), die den Workshop konzipiert haben und ihn als Moderator_innen leiten werden, über den besonderen Charakter dieser geplanten Begegnung.

Dr. Oliver von Wrochem (rechts) im Gespräch mit Swenja Granzow-Rauwald und Ulrich Gantz. © KZ-Gedenkstätte Neuengamme 2016.
OvW: Könnt ihr bitte das Konzept des Dialog-Workshops erläutern?
SGR: Wir wollen vorsichtig und behutsam die Nachkommen von NS-Verfolgten und die von NS-Täter_innen miteinander ins Gespräch bringen. Dafür geben wir allen Beteiligten Zeit und Raum. Ausreichend Zeit erscheint uns wichtig. Deswegen dauert der Workshop zwei Tagen und gibt viel Gelegenheit sich miteinander auszutauschen. Wir möchten den Workshop gerne mehrfach im Abstand von sechs Monaten anbieten. Auch dahinter steht die Absicht, viel Zeit zu lassen. Nicht jedes Thema muss beim ersten Mal erledigt werden.
UG: Wir versuchen nach Möglichkeit, dass die Nachkommen von Verfolgten und die Nachkommen von Tätern gleich stark vertreten sind. Uns ist bewusst, dass die Erfahrungen in den Familien von Verfolgten variieren können, beispielsweise wegen des Haftgrunds der Verfolgten und dessen Anerkennung oder Nicht-Anerkennung in der Nachkriegszeit, was sich auf die Sichtweise ihrer Nachkommen auswirkt. Auch die Erfahrungen bei den Nachkommen der Täter können sehr unterschiedlich sein, was unter anderem daran liegt, dass es unter ihren Tätervorfahren große Unterschiede gab, was ihre Beteiligung am NS-Regime und seinen Verbrechen betrifft. Nicht zuletzt sind wir uns auch klar darüber, dass es unter den Nachkommen auch einige gibt, die unter ihre Vorfahren sowohl Täter als auch Verfolgte zählen.
OvW: Gibt es bereits Erfahrungen mit solchen Dialog-Workshops?
UG: Im Rahmen des Evangelischen Kirchentages in Hamburg 2013 gab es in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme die Veranstaltung „Mein Vater, Dein Vater“, bei der die Tochter eines NS-Verfolgten mit dem Sohn eines NS-Täters über die Verarbeitung ihrer Familiengeschichte sprach. Ein Jahr später brachte die Mehrgenerationenbegegnung vor den Gedenkfeiern der KZ-Gedenkstätte Neuengamme Anfang Mai Nachkommen ehemaliger Häftlinge des KZ-Neuengamme, Schülerinnen und Schüler aus Hamburg und Interessierte, unter ihnen auch Nachkommen von Täter_innen, zusammen. Sie diskutierten darüber, wie das Erinnern nach den Zeitzeugen gestaltet werden könnte. Nicht nur sprachen zwei Kinder von NS-Verfolgten und zwei Kinder von NS-Tätern in diesem Rahmen auf dem Podium über ihre Familiengeschichte, sondern, und das war sicher noch entscheidender, erklärten alle Teilnehmer_innen der Mehrgenerationenbegegnung abschließend, dass die Erfahrungen bzw. das Handeln der Eltern- und Großelterngeneration kein Hindernis für eine gute Zusammenarbeit in der Zukunft sein sollten, da die Nachkommen keine Verantwortung für ihre Großeltern trügen, wohl aber eine Verantwortung für ihr eigenes Tun in Gegenwart und Zukunft.
SGR: Im Sommer 2014 gab es schließlich zwei Treffen, an denen Nachkommen von Verfolgten und von Täter_innen zusammenkamen. Im November 2014 wurde dieser Kreis noch um Personen, die nicht aus Hamburg kommen, erweitert. Zwar waren alle froh, teilgenommen zu haben, doch ein kontinuierlicher Austausch wollte nicht entstehen.
UG: Einige der Nachkommen aus Täter_innen-Familien, die an diesen Gesprächskreisen teilgenommen haben, nutzen das seit über fünf Jahren immer wieder angebotene Seminar „Ein Täter in der Familie?“ Für den Workshop im März greifen wir nicht nur auf unsere Erfahrungen aus den Treffen im Jahr 2014 zurück, sondern insbesondere auch Erfahrungen aus einem Dialog-Workshop beim Forum „Zukunft der Erinnerung“ im Mai 2015. Das war eine spannende Veranstaltung: riesiges Interesse, viel zu wenig Zeit, ein großes Durch- und Miteinander von europäischen Sprachen. Erstaunlich, was dennoch möglich war.

Teilnehmer_innen des Dialog-Workshops im Rahmen des Forums „Zukunft der Erinnerung“ 2015. © KZ-Gedenkstätte Neuengamme 2015.
SGR: Erwähnen möchten wir noch, dass es außerhalb dieser Angebote der KZ-Gedenkstätte Neuengamme viele andere Gruppen gibt. Diese arbeiten häufig auf leicht unterschiedliche Art und Weise mit der Methode des Story-Telling, d.h. alle Teilnehmer_innen erzählen über die Geschichte ihrer Familien und über ihren Umgang damit. Ich denke da an die von Dan Bar-On gegründete TRT-Gruppe, die die Pioniere auf diesem Gebiet waren, oder an Compassionate Listening und One-by-One.
OvW: Werdet Ihr auch mit dem Story-Telling arbeiten?
SGR: Nein. Bei der angedachten Gruppengröße von 16 Teilnehmer_innen ist ein Wochenende einfach zu kurz. Auch sind wir keine Psychologen und wollen nicht mit Methoden arbeiten, die uns nicht ausreichend vertraut sind. Wir haben einen etwas anderen Ansatz. Wir werden jedes Wochenende unter ein Thema stellen und dann den Teilnehmer_innen Gelegenheit geben, die eigene Position aber auch die der anderen Teilnehmer_innen kennenzulernen. Dabei wollen wir uns auf die Gegenwart und die Zukunft fokussieren und nicht so sehr in der Vergangenheit hängen bleiben. So wird das erste Wochenende unter dem Thema „Weitergabe der Erinnerung“ stehen. Was wollen wir an wen weitergeben, an unsere Gesellschaft, aber auch an unsere Familien, z.B. unsere Kinder? Besonders bei dem letzten Punkt gibt es für den einzelnen durchaus große Unterschiede. Ein Thema für ein weiteres Wochenende ist dann die Frage „Wie sehe ich mich und meine Familie in der Gesellschaft?“
UG: Bei unseren vorbereitenden Recherchen haben wir festgestellt, dass bei einigen Nachkommen der Verfolgten auch heute noch das Gefühl lebendig ist, ausgegrenzt zu sein. Das ist etwas, was für manche Nachkommen von Täter zunächst nicht verständlich ist. Als Mitglieder einer Mehrheitsgesellschaft, die nur vorgeblich tolerant ist, sind ihnen die subtilen Formen von Ausgrenzung, sei es auf Grund von Religion, ethnischer Zugehörigkeit oder sozio-ökonomischen Status, nicht vertraut. Andersherum gibt es auch Nachkommen von Tätern, die auf Grund ihrer heutigen Lebensweise von der Mehrheitsgesellschaft nicht akzeptiert werden. Die nehmen andere Formen der Ausgrenzung wahr. Ich will da jetzt nicht zu tief ins Detail einstiegen. Unser Wunsch ist, dass die Teilnehmer_innen die Vielfalt der Lebenshintergründe auf Basis der je eigenen Familiengeschichte wahrnehmen und reflektieren.
SGR: Es hilft natürlich, dass wir – ich als Enkelin von Überlebenden, Ulrich als Sohn eines NS-Täters – als Moderator_innen uns sehr intensiv mit unseren Familiengeschichten beschäftigt haben. Wir verstehen uns zwar als diejenigen, die den Austausch ermöglichen und strukturieren ohne unsere Erfahrungen in den Vordergrund zu drängen, dennoch bringen wir eine besondere Empathie für die Teilnehmer_innen mit.
OvW: Vielen Dank. Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme ist ja schon einige Zeit auf dem Weg, Geschichte nicht nur als wissenschaftliches Thema, sondern als etwas zu vermitteln, was direkt mit den Menschen und ihrem Alltag, auch der eigenen Familiengeschichte, zu tun hat. Letztendlich haben der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg das Leben von Familien auf allen Kontinenten beeinflusst und die Folgen dieser Zeit sind bis heute auf der ganzen Welt spürbar. In unserer Einwanderungsgesellschaft bleiben die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und die damit verknüpften ethischen Fragen meines Erachtens für alle bedeutsam, also auch für Menschen, die keine direkten biographischen Bezüge haben. Dies zu vermitteln, ist unser nächster Schritt.