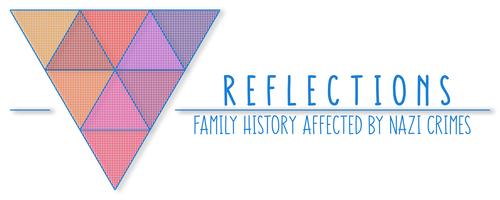Vom 30. April bis 4. Mai 2017 organisiert die KZ-Gedenkstätte Neuengamme zahlreiche Veranstaltungen anlässlich des 72. Jahrestags des Kriegsendes und der Befreiung der Konzentrationslager. Oke Spieker sprach für den Reflections-Blog mit Dr. Oliver von Wrochem, dem Leiter der Abteilung Bildung und Studienzentrum der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, sowie Elisabeth Rögler und Swenja Granzow-Rauwald, die bei der Planung und Durchführung der Formate eng mit ihm zusammenarbeiten, über das diesjährige Angebot.

Oliver von Wrochem, Elisabeth Rögler und Swenja Granzow-Rauwald bei der Planung der Veranstaltungen. © KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2017.
Oke Spieker (OS): Was macht die diesjährigen Veranstaltungen der KZ-Gedenkstätte Neuengamme anlässlich des 72. Jahrestags des Kriegsendes und der Befreiung der Konzentrationslager besonders?
Oliver von Wrochem (OvW): Zunächst möchte ich betonen, dass die Gedenkveranstaltungen am 3. Mai in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in einer langen Tradition stehen. Seit vielen Jahren wird an diesem Datum um 17 Uhr auf einer zentralen Gedenkveranstaltung der Stadt Hamburg in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme an das Kriegsende und die Befreiung erinnert, am Vormittag desselben Tages wird zudem in Neustadt/Holstein an die Opfer der Schiffskatastrophe vor 72 Jahren gedacht. Wie in jedem Jahr werden aus diesem Anlass Überlebende des KZ Neuengamme dazu eingeladen. Reden zu halten. Seit einigen Jahren bitten wir aber zusätzlich Nachkommen ehemaliger Häftlinge, zu den Gästen der Gedenkveranstaltungen zu sprechen.
In diesem Jahr wird Yvonne Cossu-Alba, Ehrenpräsidentin der französischen „Amicale de Neuengamme et des ses kommandos“ und Tochter eines im Außenlager Sandbostel verstorbenen Mitglieds der Résistance, in Neuengamme mit einem Redebeitrag vertreten sein. Sie wird über die Initiativen von Angehörigen ehemaliger KZ-Häftlinge berichten, sich stärker in die Erinnerungsarbeit einzubringen.
Elisabeth Rögler (ER): Für mich ist es immer wieder etwas Besonderes, dass Überlebende – in diesem Jahr sind es 10 –

Yvonne Cossu-Alba. © M. Casanovas, 2017.
trotz ihrer Erfahrungen in Deutschland vor über 70 Jahren, lange und teilweise sehr beschwerliche Reisen auf sich nehmen, um ihrer toten KameradInnen zu gedenken, aber auch um als ZeitzeugInnen vor SchülerInnen zu sprechen. Sie setzen damit gerade in der heutigen Zeit, in der RechtspopulistInnen überall auf der Welt wieder Hass schüren, ein wichtiges Zeichen, dass wir als Menschen aufeinander zugehen müssen. Die Freude über die Zusagen dieser KZ-Überlebenden wird leider dadurch getrübt, dass eben auch viele andere absagen mussten. Mit 90 und mehr Jahren geht es vielen von ihnen einfach gesundheitlich nicht mehr so gut, dass sie die emotionalen und körperlichen Strapazen auf sich nehmen können. Auch ist der Großteil der Überlebenden inzwischen leider verstorben.
Swenja Granzow-Rauwald (SGR): Die Frage, wie wir uns erinnern wollen, wenn die ZeitzeugInnen nicht mehr da sind, ist auch der Ausgangspunkt des diesjährigen Forums „Zukunft der Erinnerung“. Nachkommen von NS-Verfolgten und GedenkstättenmitarbeiterInnen sowie junge Erwachsene und andere Interessierte kommen am 1. und 2. Mai zusammen, um über Möglichkeiten eines nachhaltigen Erinnerns zu diskutieren. In diesem Jahr liegt der Fokus des Forums auf aktuellen Erinnerungsinitiativen. Nachkommen ehemaliger Häftlinge aus den Niederlanden, Frankreich und Belgien, die ihre Familiengeschichte literarisch verarbeitet haben, werden darüber sprechen, was sie zum Schreiben, aber auch zu ihrem gesellschaftlichen Engagement inspiriert. Überhaupt ist der Gegenwartsbezug, insbesondere der Kampf gegen Rechtspopulismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, dieses Jahr ein zentrales Thema. Jean-Michel Gaussot, Präsident der Amicale Internationale KZ Neuengamme und Sohn eines im Auffanglager Wöbbelin verstorbenen Résistance-Mitglieds, hat gefordert, den jüngsten Entwicklungen entgegenzutreten. Das wollen wir aufgreifen.

Jean-Michel Gaussot. © archives privés Jean-Michel Gaussot
OvW: Die Bedeutung der Frage „Wie Widerstand leisten – gestern und heute?“ wird auch vom diesjährigen Jugendprojekt „Stimme erheben, Stimmen bewahren“ bearbeitet. Die jungen Erwachsenen setzen sich mit den unterschiedlichen Formen und Motivationen von Widerständigen auseinander und zeigen die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in eigenen Radiobeiträgen auf. Sie können damit in den Diskussionen auf dem Forum „Zukunft der Erinnerung“ und die Beteiligung an der Gedenkfeier am 3. Mai in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme eigene Akzente setzen.
OS: Neue Akzente setzt Ihr im Programm aber auch durch die Einführung eines Austauschtreffens für Nachkommen ehemaliger Häftlinge des KZ Neuengamme.
SGR: In der Tat ist dies ein neues Format. Am 30. April kommen Nachkommen ehemaliger Häftlinge des KZ Neuengamme aus verschiedenen Ländern zusammen, um sich kennenzulernen, Wünsche gegenüber der KZ-Gedenkstätte Neuengamme zu formulieren und über eine internationale Interessenvertretung, der alle Nachkommen ehemaliger Häftlinge des KZ Neuengamme beitreten können, zu sprechen. Gegenwärtig gibt es die Amicale Internationale KZ Neuengamme, die grenzübergreifend die Interessen der Überlebenden und ihrer Nachkommen vertritt. In ihr sind VertreterInnen der nationalen Verbände organisiert. Leider gibt es jedoch in vielen Ländern, in denen Überlebende und Nachkommen ehemaliger Häftlinge leben, keine Verbände. Wir wollen aber auch den Interessen dieser Menschen Gehör verschaffen. In einer Zeit, in der das Erinnern an die NS-Verfolgten häufig nur noch an Jahrestagen stattfindet, ist es wichtig, viele Stimmen zu bündeln, um gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen.

Vertreterinnen der Häftlingsverbände anlässlich ihres jährlichen Kongresses, November 2016 (v.l.n.r. Christine Eckel (Deutschland), Jean-Michel Clère (Frankreich), Jean-Michel Gaussot (Frankreich), Shie On Bavelaar (Niederlande), Martine Letterie (Niederlande), Helle Vibeke Sørensen (Dänemark), Mark Van den Driessche (Belgien).
Foto: KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
OvW: Darüber hinaus ist es der KZ-Gedenkstätte Neuengamme sehr wichtig, verstärkt von den Angehörigen ehemaliger Häftlinge zu erfahren, welche Schwerpunkte sie sich in unserer Arbeit wünschen. Auf dem Forum 2016 wurde zum Beispiel von VertreterInnen der nationalen Verbände der Wunsch formuliert, stärker mit den Gedenkstätten an den Orten der ehemaligen Durchgangslager zusammenzuarbeiten.
ER: Wir freuen uns sehr, dass die Gedenkstätten in Compiègne (Frankreich), Amersfoort (Niederlande) und Breendonk (Belgien)VertreterInnen ihrer Einrichtungen zum Forum entsenden. Ergänzt wird diese Runde durch eine Mitarbeiterin des Regional Center for Oral History in Voronezh (Russland). Uns interessiert neben der Stellung der Gedenkstätten in ihren Heimatländern insbesondere die Arbeit dieser Einrichtungen mit Nachkommen ehemaliger Häftlinge, aber auch welche Möglichkeiten zum Austausch, z.B. zwischen Jugendlichen, bereits bestehen bzw. ausgebaut werden könnten. Wir glauben, dass wir gerade in Bezug auf die Frage nach der Arbeit von, für und mit Nachkommen von einem internationalen Austausch profitieren können. Da uns die stärkere Einbeziehung der Nachkommen aus den Staaten Osteuropas in die Arbeit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme am Herzen liegt, erhoffen wir uns vom Regional Center für Oral History neue Erkenntnisse über die Bedürfnisse dieser Gruppe sowie Tipps, wie wir VertreterInnen aus diesen Ländern besser erreichen können.
SGR: Aus dieser Perspektive freut es uns auch ganz besonders, dass sowohl am Austauschtreffen als auch am Forum eine Vertreterin des polnischen Verbands teilnehmen wird.
OS: Ein Thema, das in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle auf dem Forum gespielt hat, finde ich im Programm nicht wieder, nämlich den Dialog zwischen den Nachkommen der Verfolgten und den Nachkommen der TäterInnen. Warum?
OvW: Es ist nicht ganz richtig, dass dieses Thema komplett aus dem Programm gestrichen wurde. Vielmehr haben wir es nicht ins eigentliche Programm des Forums integriert – zu viele Themen kann man eben nicht an zwei Tagen besprechen –, sondern wir haben eine eigene Abendveranstaltung am 1. Mai für dieses Thema eingeplant. Veranstaltungsort ist die Bar GOLEM.

Barbara Brix, Ulrich Gantz, Jean-Michel Gaussot und Yvonne Cossu-Alba (v.l.n.r.) vor einer Präsentation vor französischen SchülerInnen in Perpignan. © M. Casanovas, 2017.
SGR: Ich werde an diesem Abend mit Yvonne Cossu-Alba und Jean-Michel Gaussot, den Kindern von französischen ehemaligen Häftlingen, die das KZ Neuengamme nicht überlebt haben, sowie Barbara Brix und Ulrich Gantz, den Kindern von NS-Tätern, über die persönliche und gesellschaftliche Bedeutung des Dialogs zwischen Nachkommen von NS-Verfolgten und Nachkommen von NS-Tätern sowie über die Voraussetzungen eines solchen Austausches sprechen. Dabei wird es auch um ihr Zusammenkommen mit SchülerInnengruppen im südfranzösischen Perpignan im März 2017 gehen.
OvW: Mit Abendveranstaltungen wie dieser möchten wir gerne ein breiteres Publikum erreichen. Uns ist bewusst, dass es nicht für jeden möglich ist, sich mehrere Tage mit dem Thema Erinnerung zu befassen. Eine Veranstaltung von zwei Stunden bietet da hoffentlich den richtigen Rahmen.
ER: Ähnliches gilt für die Abendveranstaltung am 2. Mai. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird Ulrike Jensen im Baseler Hof mit einem Überlebenden und seiner Familie sprechen. Dieses Jahr hat sich Ivan Moscovich zusammen mit seiner Frau Anitta bereit erklärt, über ihre Verfolgungsgeschichte zu sprechen.
OvW: Wichtig ist für Interessierte sicherlich noch, dass die Veranstaltung am 1. Mai in deutscher und englischer Sprache stattfindet, während am 2. Mai nur Englisch gesprochen wird. Eine Simultan-Übersetzung steht an diesem Abend leider nicht zur Verfügung.
OS: Ich sehe, es erwartet uns ein vielfältiges Programm. Ich danke Euch für das Gespräch.