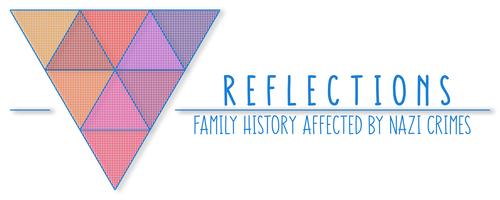„Nationalsozialistische Täterschaften“ erscheint im Metropol Verlag. © Metropol Verlag 2016.
Der Historiker Johannes Spohr, Enkel eines Wehrmachtsoffiziers, und andere Nachkommen von NS-Täter_innen lesen im Rahmen der Präsentation des Sammelbands „Nationalsozialistische Täterschaften. Nachwirkungen in Gesellschaft und Familie“ am 5. April 2016 aus ihren Beiträgen vor und sprechen mit dem Herausgeber Dr. Oliver von Wrochem über ihre Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte.*
In seinem Beitrag „Ball gegen die Auffahrt“ beschreibt Johannes Spohr die Recherche über die Taten seines Großvaters, heftige Widerstände in seiner Familie gegen seine Nachforschungen und die Erkenntnis, dass zwar manche Fragen unbeantwortet bleiben, aber dass er sich sicher sein kann, dass sein Großvater zumindest ein Opportunist gewesen ist.
In sich und anderen Nachkommen von NS-Täter_innen sieht Johannes Spohr „politische Akteurinnen und Akteure im vergangenheitspolitischen Diskurs“ (S. 508). Der damit verbundenen Verantwortung kommt er u.a. in seiner publizistischen Tätigkeit auf dem Blog Preposition nach.
Mit Swenja Granzow-Rauwald sprach Johannes Spohr über die „selektive Kommunikation“ seiner Familie über den Zweiten Weltkrieg, die Aneignung einer kritischen Sicht auf die eigene Familie, die Gesellschaft und sogar sich selbst sowie das Potential der Differenz zwischen Nachkommen von Verfolgten und Nachkommen von Täter_innen.
Swenja Granzow-Rauwald: In Ihrem Artikel „Ball gegen die Auffahrt“ stellen Sie dem Abschnitt „Glitschig und windig: Gespräche“ ein Zitat aus Adriane Altaras‘ „Titos Brille“ voran (S. 493). Welche Bedeutung hat es für Sie, aus dem Roman einer Nachkommin von NS-Verfolgten zu zitieren?

Rudol Spohr und seine Ehefrau in Nordenham, März 1942. © Privatbesitz Familie Spohr.
Johannes Spohr: Genau genommen ist das Zitat etwas unpassend, da es von einer Nachkommin von NS-Verfolgten stammt und damit einem anderen Bedeutungszusammenhang entspringt. Schweigen in Bezug auf die NS-Zeit wird zwar sowohl in Familien von Opfern und Verfolgten als auch von Täter_innen festgestellt, hat jedoch sehr unterschiedliche Ursachen und Auswirkungen. Das Zitat hat bei mir dennoch etwas angesprochen, da mir das ständige Wiederholen bestimmter Erzählungen bei gleichzeitigem Beschweigen anderer Geschichten vertraut ist. Auch in meiner Familie kursierten immer wieder Geschichten über die Zeit des Nationalsozialismus, die aber über die eigenen Rollen darin nichts aussagten. Passend finde ich das Zitat auch deshalb, weil im Zusammenhang mit NS-Täterschaft häufig allein vom »Schweigen« die Rede ist. Das allein trifft es jedoch nicht, denn bestimmte – erzählbare – Geschichten über die Zeit wurden durchaus verbreitet.
Ich würde eher von „selektiver Kommunikation“ sprechen.
Swenja Granzow-Rauwald: Sie berichten von Ihrem Kontakt zu den Menschen in den Städten und Dörfern rund um Winnyzja, wo sich Ihr Großvater während des Krieges u.a. aufgehalten hat. Was war der Inhalt dieser Gespräche? Was war besonders an diesen Gesprächen?
Johannes Spohr: Ich bekam durch meine Reisen in die Ukraine und meinen Erfahrungen in Deutschland einen Vergleich der Reaktionen auf mein Bedürfnis, über die Zeit des Nationalsozialismus und der deutschen Besatzung der Ukraine zu sprechen. Auf der einen Seite stand die Ignoranz bzw. die Abwehr in großen Teilen meiner Familie und in Nordenham, dem ehemaligen Wohnort meines Großvaters. Bevor zwei Journalist_innen etwas dazu veröffentlichten waren die Reaktionen eher passiv bis ignorant. Danach erweiterten sie sich von offensiver Abwehr über öffentliche Anfeindungen bis hin zu juristischen Drohungen. Daneben standen jedoch durchaus auch immer positive Reaktionen vieler Art.
Auf der anderen Seite erlebte ich die Offenheit und Kommunikationsbereitschaft vieler Menschen, die ich in der Ukraine traf. Auch dort gab es natürlich sehr unterschiedliche Reaktionen und Umgangsweisen mit der deutschen Besatzung, und längst nicht alle werden heute gerne behandelt. In der Regel finden sich jedoch in den Ortschaften innerhalb kürzester Zeit Menschen, die sich entweder intensiver mit der Zeit beschäftigt haben, oder auch Zeitzeug_innen, die noch selber über ihre Erlebnisse als Kinder berichten können. Sie berichten beispielsweise über den Mord an Jüdinnen und Juden sowie Roma, die Zwangsarbeit in der Ukraine und in Deutschland, den Terror gegen die Zivilbevölkerung, die Zerstörung und das Abbrennen ganzer Ortschaften, den Hunger, aber auch Partisanenaktivitäten und den Alltag während der Besatzung.
Darüber hinaus wird bei den Gesprächen immer wieder deutlich, dass sich bisher kaum jemand aus dem Land, dem die Täter_innen entsprungen sind, für diese Geschichten interessiert hat.

Unabhängig von der individuellen Verantwortung, die mein Großvater trägt, kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass auch er sich Zeit seines Lebens nicht für die Folgen der Besatzung und des Vernichtungskrieges interessiert hat, dessen Teil er war. Nicht immer habe ich erwähnt, dass ich ein Enkel einer dieser Besatzer war. Wo ich es getan habe, waren die Reaktionen jedoch auch sehr positiv. Das empfinde ich keinesfalls als selbstverständlich.
Swenja Granzow-Rauwald: Außer von Ihrer Mutter haben Sie wenig Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit der Geschichte Ihres Großvaters bekommen. Was raten Sie anderen Angehörigen der 3. und 4. Generation, die sich gegen den Willen der Familie an die Recherche oder gar das Veröffentlichen machen?
Johannes Spohr: Grundsätzlich ist es ratsam, sich mit Menschen auszutauschen, die Ähnliches tun, von deren Erfahrungen sich lernen lässt und die einen gegebenenfalls auch unterstützen können. Man sollte sich klar machen, was die eigenen Motive bei der Recherche sind und was man damit erreichen möchte. Das auch, weil sich dabei häufig ein Fass öffnet, das schwer wieder zu schließen ist. Wer genau hinschaut, ist häufig mit vorher verborgenen Abgründen konfrontiert. Sensibilität für ein Thema zu entwickeln heißt potentiell auch, Defizite in Familie und Gesellschaft zu erkennen, die sich nicht einfach beseitigen lassen. Besonders bei Veröffentlichungen kann es zudem zu einem Sogeffekt kommen, den man selbst nicht immer kontrollieren kann. Es ist zum Beispiel nicht davon auszugehen, dass die eigene Motivation in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. In meinem Fall habe ich das so erlebt, dass mir einerseits eine gewisse Allmacht in der »Lenkung« des Diskurses zugeschrieben wurde, meine tatsächlichen Aussagen jedoch immer wieder konsequent ignoriert wurden. Für Nuancen und Ambivalenzen jenseits von „Nazi oder nicht“ gab es quasi keinen Raum.
Die Voraussetzungen für ein offeneres Sprechen verändern sich mit dem Übergang zur vierten Generation und dem Ende des kommunikativen Gedächtnisses. Wer sich emotional den Groß- und Urgroßeltern trotzdem verbunden fühlt, sollte sich darüber bewusst sein, dass die Recherche nicht immer leicht ist und zu Zerrissenheit führen kann.
Allerdings ist es vermutlich belastender, sich mit den Mythen, mit denen wir aufwachsen, und den Phantasien, die wir stricken, zu begnügen und damit zu leben, als sich über die Rollen der Großeltern im Nationalsozialismus bewusst zu sein und das auszuhalten.
Nicht immer lassen sich diese Rollen jedoch mit Gewissheit und im Detail ermitteln. Das Beschweigen der Taten fortzuführen kann eigentlich keine Option sein, weder im Sinne der Verantwortung gegenüber den Verfolgten und Ermordeten, noch gegenüber sich selbst.
Swenja Granzow-Rauwald: Gibt es Ihrer Meinung nach eine „Verpflichtung“ gegenüber der Gesellschaft, die eigene Familiengeschichte öffentlich zu thematisieren?
Johannes Spohr: Das würde ich so nicht sagen. Öffentlichkeit ergibt sich meist aus einem bestimmten Kontext. Für mich ist es ein möglicher Zugang zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, andere haben andere Zugänge. Und selbstverständlich haben bei weitem nicht alle in Deutschland lebenden Menschen NS-Täter_innen in der Familie. Auch bei mir kam die Öffentlichkeit nicht durch einen eigenen Impuls dazu zustande, sondern durch eine jahrelange Dynamik und schließlich durch Anfragen, die an mich gerichtet wurden. Es war jedoch meine klare Entscheidung, keinesfalls weiter darüber zu Schweigen. Die Motivationen, nicht öffentlich zu sprechen, können sehr unterschiedlich sein. Wichtig ist erstmal, dass Räume der Kommunikation, z.B. Seminare entstehen. Daran mangelt es häufig.
In der vierten Generation ist der Bezug meist nicht mehr so unmittelbar, und auch das Sterben der Täter_innen erleichtert die Auseinandersetzung. Es stellt sich jedoch laufend die Frage, was man herausfinden möchte und zu welchem Zweck gesprochen wird. Denkbar wäre ja auch ein negativer Vorfahrenkult, der sicherlich nicht meiner Utopie entspräche. Eine „Verpflichtung“ sehe ich jedoch darin, sich kritisch mit Erinnerungsabwehr auseinanderzusetzen. Denn entgegen landläufiger Meinung lassen sich Widerstände gegen eine offene Thematisierung des NS-Erbes bis heute häufig antreffen. Das ist keinesfalls harmlos und somit inakzeptabel. Die Taten zu verschweigen oder zu relativieren heißt, das von ihnen ausgegangene Leid fortzuführen.
Swenja Granzow-Rauwald: Sie erinnern in Ihrem Artikel die Nachkommen daran, dass alle „politische Akteurinnen und Akteure im vergangenheitspolitischen Diskurs“ seien (S. 508). In welche Richtung möchten Sie diesen Diskurs richten? Welche Wünsche und Ideen haben Sie für die Zukunft der Erinnerung? Inwiefern trägt Ihre publizistische Tätigkeit dazu bei, diese Ziele zu erreichen?
Johannes Spohr: Ich möchte damit vor allem ausdrücken, dass man als Nachfahre von Täter_innen nicht einfach Opfer der eigenen Biografie ist. Ich möchte weit verbreiteten falschen Ansichten widersprechen. Viele Angehörige der dritten und vierten Generation verorten beispielsweise ihre Vorfahren als Opfer des Nationalsozialismus oder Widerständler, ohne dass es dafür eine faktische Grundlage gibt. Wer öffentlich darüber spricht, sollte sich zunächst vergewissern, auf welcher faktischen Grundlage Aussagen getroffen werden und was die Anteile eigener Zudichtungen sind.
Die reine Anerkennung, das Aushalten der Tatsachen ohne Wenn und Aber, wäre schon eine ganze Menge wert. Das beinhaltet auch, dass der Nationalsozialismus so lange nicht »lange her« sein kann, wie seine Wirkmächtigkeit fortbesteht und viele Menschen nicht zuletzt vom Umgang damit von der Nachkriegszeit bis heute geprägt sind. Auf die Erinnerung gibt es weder eine Prämie, noch wird ihr Ausbleiben bestraft.
Aber nur wer sich erinnert, kann sich emanzipieren.

Gedenkstein für die jüdischen ermordeten Kinder in Winnyzja. © Privatbesitz Johannes Spohr.
Erinnerung verstehe ich nicht als bloßes Ritual an Gedenktagen, sondern als aktive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Dazu kann auch gehören, sich in aktuelle Diskurse einzubringen, beispielsweise zur bis heute von der Bundesregierung verweigerten Entschädigung von Opfern und Hinterbliebenen von Massakern. Staatlich inszenierte Erinnerung verdient immer eine gewisse Skepsis, denn sie dient auch immer dem Zweck der Legitimierung heutiger Regierungspolitik. Erinnerung bedeutet – mit Ruth Klüger – streitsüchtig zu werden und die Auseinandersetzung zu suchen.1
Meine publizistische Aktivität kann einen Beitrag dazu leisten. Dass dies im Fall Nordenham zu einer gewissen Aufmerksamkeit auf das Thema geführt hat, halte ich für begrüßenswert, auch wenn ich eher skeptisch bin, was die Ergebnisse angeht. Es bräuchte im Grunde wesentlich mehr: Ausstellungen, Diskussionsveranstaltungen, Seminare und Interventionen. Dafür Partner_innen zu finden ist aber nicht immer und überall ganz einfach.
Swenja Granzow-Rauwald: Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach der Dialog zwischen Nachkommen von Verfolgten und Nachkommen von Täter_innen für die Zukunft der Erinnerung?
Johannes Spohr: Die Dimensionen der NS-Verfolgung und -Vernichtung lassen sich allein durch die Beschäftigung mit dem Nachlass (mündlicher wie schriftlicher Art) der Täter_innen nicht fassen. Für mich hatte und hat beispielsweise die Literatur von Überlebenden für die Vergegenwärtigung eine besondere Bedeutung. Sich mit den Dokumenten meines Großvaters zu konfrontieren, wäre ohne die Eindrücke aus Büchern von Jean Améry, Primo Levi oder Ruth Klüger einseitig und beschränkt gewesen. Ähnliches gilt für den Austausch mit Nachfahren von Verfolgten und Ermordeten, in Projekten, auf Veranstaltungen, in Freundschaften.
Im Dialog zwischen den Nachkommen von NS-Verfolgten und Nachkommen von Täter_innen können Gemeinsamkeiten, vor allem aber auch Differenzen entdeckt werden. Das erlebe ich nicht als negativ. Im Gegenteil: Die Anerkennung dieser Differenzen kann den Blick schärfen und eine Grundlage für eine Annäherung liefern.