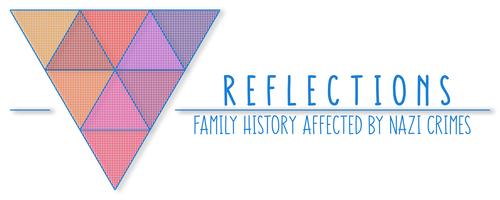Interview mit Alexandra Senfft

Am Dienstag, den 5. April 2016, spricht Alexandra Senfft im Rahmen der Präsentation des Sammelbands „Nationalsozialistische Täterschaften. Nachwirkungen in Gesellschaft und Familie“ gemeinsam mit anderen Nachkommen von Täter_innen mit dem Herausgeber Dr. Oliver von Wrochem über ihre Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte.
In ihrem Beitrag „Drei Generationen und eine Erinnerungsreise“ berichtet Alexandra Senfft von ihrer Reise mit ihrer Tochter Magdalena nach Bratislava zu einem bewegenden Treffen mit dem Shoah-Überlebenden Tomi Reichental, der einen Großteil seiner Familie durch den Holocaust verloren hat. Außergewöhnlich an dieser Begegnung war, dass Alexandra Senfft die Enkelin des „Gesandten des Dritten Reiches in der Slowakei“ ist, der somit mit verantwortlich für die Deportation der Verwandten von Tomi Reichental war.
Bereits 2007 wagte Alexandra Senfft mit „Schweigen tut weh“ den Schritt, mit ihrer Familiengeschichte und den Auswirkungen der Verbrechen ihres Großvaters auf die folgenden Generationen an die Öffentlichkeit zu gehen. In ihrem im Mai 2016 erscheinenden Buch „Der lange Schatten der Täter“ tritt sie in einen Dialog mit anderen Nachkommen von NS-Täter_innen und zeigt auf, warum das Erinnern für Gegenwart und Zukunft essentiell ist und bleibt.
Mit Swenja Granzow-Rauwald sprach Frau Senfft über ihre Veröffentlichung der Familiengeschichte, die transgenerationellen Folgen der NS-Zeit und die Voraussetzungen für einen gelungenen Dialog.
Swenja Granzow-Rauwald (SGR): Lassen Sie uns bitte zunächst über die Begegnung mit Tomi Reichental, dem Shoah-Überlebenden, sprechen, die Sie in Ihrem Artikel „Drei Generationen und eine Erinnerungsreise“ schildern. Sie deuten an, dass das Gefühl von Nähe zwischen Ihnen beiden damit zu tun habe, dass Sie beide mit ihren Familiengeschichten an die Öffentlichkeit gehen. Was verändert es in einem Menschen, mit seiner Familiengeschichte an die Öffentlichkeit zu gehen?
Alexandra Senfft (AS): Ich würde nicht sagen, dass Tomi Reichental und ich uns so gut verstehen, weil wir an die Öffentlichkeit gegangen sind. Wir hätten uns sicherlich auch sehr gut verstanden, wenn wir es nicht getan hätten. Allerdings haben wir natürlich dadurch, dass wir diesen Schritt an die Öffentlichkeit gemacht haben, gewissermaßen auch eine gemeinsame Arbeit miteinander vollbracht. Wir sind beide der Überzeugung, dass es wichtig ist, uns mit unseren Geschichten zu zeigen und darüber einen Diskurs anzuregen.
An die Öffentlichkeit zu gehen ist ein zusätzlicher Schritt des Sich-der-Geschichte-Stellens.“
Man kann natürlich im privaten Rahmen darüber sprechen, innerhalb der Familie, mit Freunden oder innerhalb irgendwelcher Gruppen. Aber mit der Geschichte rauszugehen, sich der Öffentlichkeit zu stellen, ist ein weiterer Schritt, für den man mehr Mut braucht, weil man nie weiß, wie wird die Öffentlichkeit überhaupt auf einen reagieren.
SGR: Welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein, wenn man an die Öffentlichkeit gehen will?
AS: Man muss innerlich gut vorbereitet sein. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Ich denke, ein positiver Effekt ist, dass es einen selbst in der eigenen Position noch weiter stärkt. Wenn ich mich schon an die Öffentlichkeit traue, bin ich auch wirklich überzeugt von dem, wofür ich stehe. Letztendlich wird das Private dann politisch. Es ist ein politischer Schritt, die eigene Geschichte öffentlich zur Verfügung zu stellen.
Gerade mit einer Täter-Geschichte trifft man in der Öffentlichkeit auf dieselben Ambivalenzen, die man innerlich beziehungsweise innerhalb des persönlichen Umfelds hat. Das heißt: Man bekommt Zuspruch. Man erfährt Kritik. Man wird mit den Zweifeln anderer konfrontiert. Aber man wird auch bestärkt. Im Grunde spiegelt sich das ganze Spektrum der eigenen inneren Aufarbeitung in der Öffentlichkeit wieder.
Ich glaube, wenn man seine Geschichte nicht gut bearbeitet hat, kann der Schritt in die Öffentlichkeit gefährlich sein, weil man daran auch zerbrechen kann.
SGR: In Ihrem Beitrag erzählen Sie von dem Psychologen Jürgen Müller-Hohagen, der sich nach der Veröffentlichung von „Schweigen tut weh“ bei Ihnen meldete und Ihnen riet, sich zu schützen. Würden Sie sagen, dass Sie zu dem Zeitpunkt, also noch am Anfang des An-die-Öffentlichkeit-Gehens, an dieser Schwelle zum Zerbrechen waren?
AS: Nein, das würde ich so nicht sagen. Aber es war natürlich alles sehr neu für mich. Das ist jetzt bald zehn Jahre her. Jürgen Müller-Hohagen vom Dachau Institut Psychologie und Pädagogik, auf den ich ganz zum Schluss meiner Schreibarbeiten als Experten gestoßen war, hatte ich damals gebeten, mein Manuskript zu lesen. Ich glaube, ihn bewegte oder interessierte einfach, wie es mir nach dem Erscheinen des Buches ging.
Im Grunde war seine Nachricht damals: „Frau Senfft, passen Sie gut auf sich auf.“ Das meinte er natürlich sowohl in Hinsicht auf die Familie als auch auf die Öffentlichkeit. Es ging darum, ob ich mich genügend abgrenze. Sauge ich diese negativen Energien, die man sowohl von der Familie als auch von der Öffentlichkeit empfängt, auf oder bin ich innerlich dagegen gerüstet, damit sie nicht zu viel Einfluss auf mein Leben bekommen?
Und das können sie. Das habe ich gemerkt. Ein Schlüsselmoment fand statt, als eine Freundin mich fragte:
Wieso liest Du eigentlich die Briefe, die Du von Angehörigen bekommst, überhaupt noch? Du weißt doch, was drin steht. Warum tust Du Dir das an?
Natürlich war ich da noch sehr am Anfang der innerlichen Auseinandersetzung. Das ist ja ein langer Weg. Das Befreiende kommt nicht von heute auf morgen, sondern man wächst da hinein, und das ist auch sehr anstrengend.

„Nationalsozialistische Täterschaften“ (Metropol Verlag). © Metropol Verlag 2016.
SGR: Es gibt Personen, die von vornherein sagen, sie können sich mit der Familiengeschichte nicht auseinandersetzen, oder sie merken es im Prozess. Gibt es eine Art von „Verpflichtung“ sich selbst oder der Gesellschaft gegenüber, sich öffentlich mit der Familiengeschichte auseinanderzusetzen?
AS: Ich würde nicht grundsätzlich von Verpflichtung sprechen. Ich nenne es eher Verantwortung. Es ist nicht meine Bürgerpflicht, meine Geschichte offenzulegen. Ich differenziere, ob und in welcher Form ich meine Geschichte preisgebe. Das hängt auch ein wenig davon ab, ob es sich bei der belasteten Person um eine Person der Öffentlichkeit handelt, wie z.B. mein Großvater. Auch die Väter von bekannten Politikern waren Personen der Öffentlichkeit und die Kinder sind es oft auch. Da würde ich von einer politischen Verantwortung sprechen. Jedenfalls empfinde ich da das Private als politisch. Man könnte damit innerhalb einer Gesellschaft dialogisch viel anregen.
Doch viel aufschlussreicher als die namhaften NS-Täter sind doch all die kleinen Täter, Mitläufer und Zuschauer – sie erklären uns viel besser, warum fast eine gesamte Gesellschaft zu Massenmördern wurde. Dennoch gibt es keine Verpflichtung, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe ja auch vorhin eingeschränkt, dass nicht jeder dazu in der Lage ist, weil man dazu innerlich auch bereit sein muss, egal ob es in der Familie Zuschauer, Mitläufer oder Täter gegeben hat. Man muss psychisch dafür gewappnet sein. Jeder soll seinen eigenen Weg finden, wie er oder sie damit umgeht.
Unter diesen genannten Voraussetzungen finde ich es wichtig, dass man an die Öffentlichkeit geht, mit den Geschichten, die bis dahin nur auf dem Dachboden oder gar in den Herzen lagerten.Wenn man sie nach draußen bringt, zeigt man anderen Leuten, dass es möglich ist, sich damit zu befassen, man darüber reden kann, man sogar darüber reden muss.
SGR: Welche Reaktionen hat es damals auf „Schweigen tut weh“ gegeben?
AS: Meine Erfahrung mit „Schweigen tut weh“ ist, dass ich im Großen und Ganzen eine sehr behutsame Öffentlichkeit erlebt habe. Die Mehrzahl der Leser und Zuhörer bei meinen Lesungen und Auftritten waren im Grunde überwiegend sehr dankbar, dass ich mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen bin, weil es ihnen Mut gemacht hat, ihre eigenen Geschichten anzugehen, zu recherchieren und vielleicht sogar etwas zu schreiben. Ich habe dadurch einen Diskurs in Gang gebracht und andere bestärkt, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, sich vielleicht auch nur Gedanken zu machen, die sie sich vorher nicht gemacht hatten.
SGR: Was zeichnet Ihr neues Buch „ Der lange Schatten der Täter“ aus?

AS: In „Der lange Schatten der Täter“ trete ich wiederum mit meiner eigenen Geschichte an die Öffentlichkeit, aber im Dialog mit anderen Menschen, die den Mut haben, ihre Geschichte öffentlich zur Verfügung zu stellen, die ich porträtiere. Das sind zum Teil sehr belastete, sehr komplexe, sehr schwierige Biografien. Sie stellen sich den NS-Geschichten ihrer Familien wirklich.
Ich bin sicher, dass es viele Leser geben wird, die sich mit der einen oder anderen Geschichte identifizieren und sich deshalb nicht mehr so alleine fühlen werden. Wenn man an die Öffentlichkeit geht, zeigt man auch, dass es Menschen gibt, die das Schweigen brechen, sich auseinandersetzen und dass es nicht nur für uns und unsere Familien, sondern auch für die Gesellschaft wichtig ist, sich mit der schuld- und schambeladenen Vergangenheit auseinanderzusetzen.
SGR: Sie sind der Meinung, dass nicht jeder die psychischen Voraussetzungen mitbringt, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber was ist mit jenen Menschen, die stabil genug wären, aber den einfachen Weg wählen, sich nicht auseinanderzusetzen?
AS: Ich empfinde das als problematisch. Ich denke, dass alles, was nicht aufgeklärt wird, sich in irgendeiner Form heute oder in der nächsten Generation wieder zeigt. Wenn man sich mit der Familiengeschichte konfrontiert, verliert man zwar einerseits vielleicht etwas. Andererseits gewinnt man auch viel, nämlich Klarheit.
Man läuft nicht mehr irgendwelchen Vermutungen hinterher, die in Wahrheit doch immer an einem nagen. Das kostet Energie, die man viel konstruktiver einsetzen könnte.
SGR: Was raten Sie gerade jungen Menschen, die zwar Informationen zur Familiengeschichte von Eltern und Großeltern erhalten, gleichzeitig aber auch auf Widerstand stoßen, insbesondere was den Gang an die Öffentlichkeit betrifft?
AS: Da sollte man sich selbst vertrauen, dem Instinkt folgen und im besten Fall darüber reflektieren, was man eigentlich erreichen will. Mache ich es für mich persönlich oder eher für Geschwister, jüngere Verwandte oder die Kinder? Bin ich mit mir im Reinen in der Art und Weise, wie ich die Familiengeschichte betrachte und beschreibe?
Wichtig ist dabei die Frage, wie macht man eigentlich diese Aufklärung innerhalb der Familie? Tue ich das mit einem gewissen Respekt gegenüber der Perspektive der anderen? Akzeptiere ich, dass sie vielleicht nicht anders können oder nicht anders wollen? Oder wähle ich eine destruktive Art und Weise, bei der ich die Menschen abwerte, um die es geht? Die Herausforderung ist, zu trennen zwischen dem Menschen und der Menschlichkeit einerseits und den Fakten andererseits, die an diesen Menschen haften.
Mein Beispiel, das ich in „Schweigen tut weh“ klarmache und nun auch in meinem neuen Buch „Der lange Schatten der Täter“ thematisiere, ist, dass ich nicht meine Großeltern in ihrer Gesamtheit anklage.
Ich versuche nachzuvollziehen, wie kommen ganz normale Menschen dazu, zu Tätern, Mitläufern und Zuschauern zu werden? Sie bleiben Menschen, auch wenn sie Täter werden. Wenn wir sie dämonisieren und in ihrer Gesamtheit verdammen, werden wir nie verstehen, wie Menschen zu Tätern werden können. Die menschliche Seite ihres Charakters in ihrer Unmenschlichkeit müssen wir im Auge behalten
SGR: Wie können sich jüngere Menschen gegen Angriffe auf ihre kritische Sicht auf die Familiengeschichte wehren?
AS: Ich finde nicht, dass die ältere Generation ein Recht hat, den Jüngeren ihre Perspektive darauf zu verbieten. Niemand hat ein Monopol auf die Familiengeschichte. Es dürfen verschiedene Perspektiven, die sich widersprechen, nebeneinander existieren. Und jede und jeder darf seinen eigenen Weg finden, wie er oder sie seine Aufarbeitung macht im breiten Spektrum zwischen ganz privat und in der Öffentlichkeit. Und dann ist die Frage, wie man die Öffentlichkeit sucht. Es gibt viele verschiedene Ausdrucksformen, von denen jeder seine eigene wählen muss.
Wenn man den innerlichen Drang nach Aufklärung hat, dann ist das oft ein steiniger Weg, für den man viel Mut braucht. Auf dem man auch auf viele Hürden stoßen wird. Das können Schuldgefühle gegenüber der Familie sein, Ängste, große Zweifel. Zu der Auseinandersetzung gehört auch, dass man sich mehr abgrenzt von der Familie. Das ist ein gesunder psychischer Prozess. Man verabschiedet sich von falschen Loyalitäten.
SGR: Hatten Sie diese Einstellung zum Beginn Ihrer Auseinandersetzung?
AS: Im Prinzip habe ich meinen eigenen Prozess in „Schweigen tut weh“ und in anderen Texten beschrieben. Meine Einstellung ist über eine ganz lang Zeit gewachsen. Für mich fing es an mit Vermutungen. Als ich am Grab meiner Mutter vor der Familie laut und deutlich einen Zusammenhang herstellte zwischen ihrem Schicksal und dem Kriegsverbrecher, ihrem Vater. Es hat auch andere entscheidende Momente in meinem Leben gegeben, so z.B. die Begegnung mit dem israelischen Psychologen und Praktiker Dan Bar-On und dessen Arbeit. Meine Arbeit in Israel hat mich natürlich mit dem Thema auch immer wieder konfrontiert.
Der springende Punkt war dann der Tod meiner Mutter, der so viele Rätsel aufgegeben hat, dass ich den inneren Drang empfand, herauszufinden, was da eigentlich losgewesen war.
Der Film meines Onkels Malte Ludin war der Katalysator, den ich ganz zum Schluss brauchte, um zu sagen: „Jetzt langt’s.“ Meine Mutter ist in diesem Film nur auf Fotos zu sehen, die ich Malte zur Verfügung stellte. Ihre Stimme fehlt aber. Sie war und bleibt eine „Leerstelle“ im Film meines Onkels. Das war für mich dann der Punkt, an dem ich mir gesagt habe: „Meine Mutter hat es nicht geschafft. Jetzt muss ich ran.“
Ich werde meinem Onkel ewig dankbar dafür sein, dass er diese Leistung vollbracht und dass er diesen Film in die Öffentlichkeit gebracht hat. Die eigentliche Auseinandersetzung kam dann mit meinem Buch.
SGR: Sie berichten von einem Unverständnis gegenüber einer „Generation, die ihre Kinder und Kindeskinder um die Wahrheit betrogen hat“ (S. 478). Was wollen Sie an Ihre Kinder weitergeben?
AS: Für mich war die Reise mit meiner älteren Tochter Magdalena nach Bratislava sehr überraschend, weil sie anfangs nicht mitwollte. Sie war erst nicht so interessiert.
In dem Moment aber, als wir ankamen und sie die Begegnung zwischen mir und Tomi Reichental erlebte, war sie emotional und kognitiv angesprochen. Ich war verblüfft, dass sie dann auch zu einem Interview bereit war und vor laufenden Kameras dieses Gespräch mit Tomi Reichental geführt hat. Mich hat beeindruckt, was sie, zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt, beobachtet, analysiert und bewertet hatte. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe ihr meine Perspektive auf die Geschichte weitergegeben, das was ich für die Wahrheit halte, nämlich die Fakten. Meine Kinder müssen sich die drängenden Gedanken nicht mehr machen, die ich mir gemacht habe. Sie müssen nicht mehr Vermutungen anstellen, sondern sie haben absolute Klarheit darüber, was in der Vergangenheit gewesen ist.
Auf der Reise ist für meine Tochter die Vergangenheit in die Gegenwart geholt worden. Magdalena wurde plötzlich politisch und hat verstanden, was es für die Gegenwart bedeutet, wenn wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Sie ist sehr sensibel geworden gegenüber Menschenrechtsverletzungen und engagiert sich gegen die Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts.
Für mich zeigt das, dass ich an sie weitergegeben habe, wie man als Bürgerin die Menschenrechte verteidigt und sich in dieser Gesellschaft positioniert. Für mich war auf der Reise auch sichtbar, dass ich tatsächlich das Familiennarrativ durchbrochen habe.
Wir haben eine Reise in die Erinnerung gemacht, die uns in der gesamten Zukunft erhalten bleiben wird.
SGR: Für viele gibt es diese offensichtliche biographische Verbindung nicht. Sie werden dann an Gedenktagen etc. mit der Geschichte konfrontiert. Wie bewerten Sie diese Formen des öffentlichen Gedenkens?
AS: Ich finde es im Prinzip sehr wichtig, Jahrestage zu haben. Ein öffentliches Gedenken gibt immer wieder Anlass, dass private Gedenken zu reflektieren und zu besprechen. Ich halte Gedenktage für am nachhaltigsten, wenn auf hohle Rituale, hinter denen man auch vieles verstecken kann, verzichtet wird. Man muss auch klar trennen, ob so ein Gedenktag politisch instrumentalisiert wird, oder ob er die Erinnerung auch im tieferen, menschlichen Sinne bewahrt. Für mich ist es das effektivste, wenn der öffentliche und der private Raum sich gegenseitig ergänzen. Dann wird die Erinnerung nicht monopolisiert. Die Verzahnung unterschiedlicher Erinnerungsformen wäre für mich der Weg, um wachsam zu bleiben und tatsächlich zu erinnern.
SGR: Wie kommt es zu der Formulierung „wachsam“ in Bezug auf Erinnerung?
AS: Wenn man tatsächlich reflektiert, was damals passiert ist und sich die Mechanismen klar macht, die vermeintlich zivilisierte Menschen zu Barbaren gemacht haben, dann wird man auch sensibler für gesellschaftliche Polarisierungen heute, für neue Fremdbilder, für neue Ausgrenzung und vor allem für menschenverachtendes Verhalten, wie es etwa Pegida oder die AfD an den Tag legen. Ich denke, dass sich hier zeigt:
Der Nährboden des Nicht-Erinnerns zeitigt neuen Hass und Rassismus.
Man muss wachsam bleiben, damit man schon die Anfänge erkennt und dagegen steuert, unter Umständen auch mit der eigenen Biografie, mit der eigenen Erfahrung.
SGR: In Ihrem neuen Buch treten Sie in einen Dialog mit anderen Nachkommen, die auf Täter-Seite zu verorten sind. Ihre Begegnung mit Tomi Reichental beinhaltete aber eine andere Form von Dialog. Was würden Sie als die Grundvoraussetzung für einen gelungenen Dialog zwischen den Nachkommen der Verfolgten und der Täter sehen?
AS: In „Der lange Schatten der Täter“, das am 2. Mai erscheint, beschreibe ich, was man von einem Dialog erwarten kann und was man nicht erwarten sollte. Eine der Grundvoraussetzungen für einen gelungenen Dialog ist Vertrauen. In diesem Fall müssen die Nachkommen der Verfolgten das Vertrauen in die Nachkommen der Täter haben können, dass diese sich wirklich kritisch mit der eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt haben und nicht bewusst oder unbewusst noch immer das Motiv haben, zu rechtfertigen, zu leugnen oder zu verdrängen.
Es ist ganz wichtig, die Karten offen auf den Tisch zu legen, damit es keine Angst vor einer Instrumentalisierung gibt. Diese Instrumentalisierung könnte bedeuten, dass jemand einen Dialog mit den Nachkommen der Verfolgten sucht, weil er oder sie sich eigentlich entlasten möchte – da wird „das Opfer“ benutzt, um die Schuld- und Schamgefühle abzuschütteln.
Auch viele Nachkommen von Verfolgten hoffen immer wieder, dass es in irgendeiner Weise zu einer Art Versöhnung kommen, etwas Heilendes im Dialog gefunden werden kann.
Das Anliegen ist natürlich vollkommen legitim, weil die Verletzungen so unglaublich groß sind, dass alle am Dialog Beteiligten auf eine Art Heilung oder gar „Erlösung“ hoffen. Erlösung gibt es meines Erachtens aber nicht. Trost und Heilung indes sind das Maximum, was wir von einem solchen Prozess erwarten können.
Ich suche nicht nach Versöhnung in diesen Begegnungen, auch wenn ich das Bedürfnis kenne und verstehe. Es ist schön, wenn eine Versöhnung stattfindet, aber ein Dialog darf nicht mit dieser Erwartung begonnen werden. Nicht Versöhnung, ergo Entlastung, darf das Ziel sein. Man muss auch bereit sein, sehr unangenehme Situationen durchzustehen, schlechte Gefühle dabei zu haben und gewisse Grenzen der Nähe bzw. die Distanz zu akzeptieren.
Abschließend – und hierzu schreibe ich ausführlich in meinem neuen Buch – müssen wir uns beim Dialog immer die Frage stellen: Was machen wir daraus? Wir müssen auch Visionen entwickeln, was wir mit
Ich habe immer große Bedenken gegenüber Dialogen, die eher Begegnungen sind, von denen Entlastung erhofft wird. Wenn solche Begegnungen scheitern, dann reinszeniert man eigentlich etwas aus der Vergangenheit, was sehr destruktiv sein kann. Gescheiterte Dialoge auf Grund der fortdauernden Verstrickung auf beiden Seiten können besonders schrecklich sein – sie führen zu weiterer Verbitterung und Trauer. Sie sind letztendlich ein Triumph für das, was die Nazis erreichen wollten.
Ich denke, der Leitfaden sollte immer Menschlichkeit sein.
[*] Zu dem Sammelband gehört auch der Film „Nationalsozialistische Täterschaft in der eigenen Familie. Erinnerungsberichte der zweiten und dritten Generation“, in dem Nachkommen von Täter_innen von ihrem Umgang mit der Geschichte der Täter_innen in der eigenen Familie berichten.