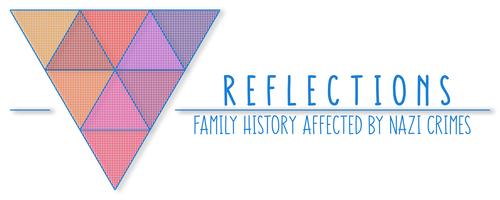Können Nachfahren von NS-Tätern zu einem konstruktiven Erinnerungsprozess beitragen?

Barbara Brix 2014. © Mark Mühlhaus, attenzione photographers, 2014.
Noch vor nicht allzu langer Zeit hätte ich diese Frage mit einem Kopfschütteln oder achselzuckend beantwortet. Heute möchte ich dennoch versuchen, meine persönlichen Erfahrungen zu dem angestrebten Austausch unter den Nachfahren von Verfolgten und Tätern beizusteuern.
Recherchen über meinen Vater
Ein später Hinweis
Wie schon hier und da berichtet, habe ich im Jahre 2006, kurz vor meiner Pensionierung als Lehrerin, von einem befreundeten Historiker erfahren, dass mein Vater nicht, wie die Familiensaga behauptete, im Zweiten Weltkrieg „an der russischen Front“, sondern bei den Einsatzgruppen gewesen wäre.
Ich hatte keine Ahnung und wusste auch sonst wenig über seine Haltung und seine Aktivitäten während der NS-Zeit. Das war kaum jemals Thema in unserer sonst sehr austauschfreudigen Familie gewesen.
Als ich im vergangenen Jahr die Ergebnisse meiner mehrjährigen Recherchen für ein von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme geplantes Buch zusammenstellte und aufschrieb, war damit für mich die Entscheidung gefallen, dieses Stück Familiengeschichte öffentlich zu machen.
Privat oder öffentlich?
Mein ursprünglicher Antrieb war allein der, wissen zu wollen, wie tief mein Vater in die nationalsozialistischen Verbrechen verstrickt war. Nach sieben Jahren oft zögerlicher und immer wieder unterbrochener Recherchearbeit hielt ich inne. Mein Eindruck war, dass ich das vorhandene Quellenmaterial ausgeschöpft hätte und mir ein abschließendes Bild machen könne: mein Vater war Mitwisser und Täter – in dem Sinne, dass er sich aus tiefer Überzeugung dem NS-System zur Verfügung gestellt, eineinhalb Jahre als Arzt bei der Einsatzgruppe C in der Ukraine und dann noch einmal eineinhalb Jahre bis zu seiner Verwundung bei der Waffen-SS in Frankreich Dienst getan hatte.
Aber – so war mein Fazit – er hatte nie an den Vernichtungsaktionen persönlich teilgenommen. Damit kamen meine privaten Nachforschungen zum Ende, und so privat sollten sie auch bleiben. Ich erzählte nur meinen Geschwistern und wenigen Freunden davon. Eine weitere Verbreitung erschien mir unpassend, irgendwie unziemlich. Auch weil mir beim Nachdenken über meinen Vater mein eigener Anteil an der Kommunikationslosigkeit deutlich geworden war: mein Vater hatte nichts erzählt, aber ich hatte auch keine wirklichen Fragen gestellt.
Eine Konferenz über die Weitergabe von NS-Täterschaft in den Familien
Während einer von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme ausgerichteten Konferenz sah ich mich zu meiner Überraschung mit dem ganzen Spektrum der Forschungen zu den NS-Tätern konfrontiert, von den persönlichen Auseinandersetzungen ganz zu schweigen: von Niklas Franks krassen Hassattitüden gegen seinen Nazivater über anrührende Eingeständnisse von Hilflosigkeit bis hin zu reflektiertem, bewussten Umgang mit der eigenen Geschichte.

Barbara Brix berichtete im Mai 2014 auf der Mehrgenerationenbegegnung vor Überlebenden des KZ Neuengamme und ihren Angehörigen vom Umgang ihrer Familie mit der Geschichte ihres Vaters. © Mark Mühlhaus, attenzione photographers, 2014.
Und plötzlich hatte ich einen Erkenntnisblitz: wenn möglichst viele von uns aus der zweiten oder dritten Generation die Einstellungen und Handlungen ihrer (Groß-)Väter untersuchen und sich ihnen stellen würden, könnte davon vielleicht eine klärende, heilende Wirkung für die gesamte deutsche Gesellschaft ausgehen und „der Schoß […], aus dem das kroch“ (Bertold Brecht im Epilog des Theaterstücks „Der aufhaltsame Aufstieg von Arturo Ui“ von 1941) endlich austrocknen. So erklärte ich mich – noch unsicher zwar, aber schließlich doch – bereit, für ein geplantes Buch in der Gedenkstätte und auch dem „Spiegel“, der damals gerade auf dieses Thema verfallen war, über meine Recherchen zu berichten.
Es fiel mir schwer, darin auch den vollen Namen meines Vaters zu nennen. War das nicht so etwas wie ein Verrat an jemandem, der sich nicht mehr wehren konnte? Andererseits schien mir dies eine notwendige Konsequenz meiner Suche nach der Wahrheit zu sein.
Die subjektive Seite
Einen Brief an meinen Vater?
War damit die objektive Seite meines Erkenntnisprozesses abgeschlossen, so spürte ich doch, dass es auch eines emotionalen Ergebnisses bedurfte: Welche Schlussfolgerungen sollte ich aus meinen Nachforschungen ziehen?
Eine Freundin schlug mir vor, einen posthumen Brief an meinen (1980 verstorbenen) Vater zu schreiben und symbolisch die Schuld an ihn zurück zu geben. Die Idee fand ich nicht schlecht. Aber wieso eigentlich Schuld? Es war ja offensichtlich, dass ich – 1941 geboren – nicht schuldig geworden war. Irgendetwas in mir wehrte sich dagegen, diesen Brief zu verfassen.
Die Mehrgenerationenbegegnung in Neuengamme Mai 2014

Ich war eingeladen worden, mit drei anderen Vertretern meiner Generation auf dem Podium Platz zu nehmen: außer mir noch ein anderer Nachfahr eines NS-Täters, zwischen uns jeweils ein Sohn bzw. Neffe aus einer Verfolgtenfamilie. Man hatte uns gebeten, uns zugetraut, vor einer größeren Gruppe von Kindern und Enkeln ehemaliger Häftlinge aus Neuengamme über unsere Familien, deren Geschichte und uns selbst zu sprechen.
Soweit ich weiß, war es die erste Begegnung dieser Art vor einem solchen Publikum, und nach meinem Eindruck waren wir alle ziemlich aufgeregt. Wir beiden „Täterkinder“ fühlten uns, wie es der eine formulierte, als wären wir „nicht auf der richtigen Veranstaltung“ – so als hätten wir nicht das Recht, im Kreis dieser Menschen zu sprechen.
Als das Podiumsgespräch nach zwei Stunden zu Ende war, trat in dem Saal eine tiefe, schwer zu deutende Stille ein. Schließlich erhob sich Jean-Michel Gaussot, Altersgenosse, Sohn eines französischen Résistance-Kämpfers, der kurz vor Ende des Krieges im Neuengammer Auffanglager Wöbbelin umgekommen war.
Er habe verstanden, sagte er, dass die Kinder der NS-Täter ebenfalls an einer Bürde zu tragen hätten. Aber diese familiengeschichtliche Last dürfe uns nicht trennen, sondern könne vielmehr eine Basis für die gemeinsame Arbeit an der Erinnerung und gegen eine Wiederkehr jener unmenschlichen Verhältnisse abgeben.
Diese wenigen Worte haben einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Es war, als reichte uns Jean-Michel seine Hand über einen Abgrund hinweg – eine Geste der Versöhnung, die mich von einem Augenblick zum anderen von einem Schuldgefühl befreite, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es mit mir herumtrug.
Transgenerationelle Prozesse
Über diese Empfindung habe ich lange nachgedacht. Zwar war mir schon früher der Gedanke gekommen, dass es einen Zusammenhang zwischen den Kriegserlebnissen meines Vaters und meiner fast schon obsessiven Beschäftigung mit dem Thema Nationalsozialismus – vor allem nach seinem Tode – geben müsse. Als Lehrerin hatte ich zahlreiche Unterrichtseinheiten und Projekte (z.B. zum Außenlager des KZ Neuengamme in der Spaldingstraße in Hamburg) zu diesem Thema initiiert; meine Lektüre drehte sich fast ausschließlich darum.
Die letzte Phase der Schwangerschaft meiner Mutter und meine Geburt im Spätsommer 1941 fielen zeitlich mit dem Einfall der Wehrmacht in die Länder der Sowjetunion zusammen. Beinahe täglich schwärmten Untereinheiten der sie begleitenden Einsatzgruppen auf ihrem Vormarsch in die umliegenden Dörfer aus und brachten systematisch deren jüdische Einwohner um. Mein Vater war mehr oder weniger Teil des Geschehens. Zumindest war er Ende September 1941, zwei Wochen nach meiner Geburt, in Kiew, als dort mehr als 33.000 Juden am Stadtrand, bei der Schlucht von Babi Yar, an zwei Tagen umgebracht wurden. Danach erhielt er Urlaub, um seine Frau und seine neu geborene Tochter in Breslau zu besuchen.
Erst in der letzten Zeit habe ich gelesen und verstanden, dass es von einer Generation zur nächsten oder auch zur übernächsten so etwas wie eine nonverbale Weitergabe (hierzu z.B. Angela Moré, 2013) unbearbeiteter Gewalterfahrungen, von ungesühnter Schuld geben kann. Wäre es so, dass ich die Schuld meines Vaters, die er vermutlich nicht angesehen, nicht hinterfragt hat, unbewusst übernommen habe mit der gefühlten Verpflichtung, etwas wieder gut machen zu müssen, etwas zu reparieren?
Brücken bauen
Seit Kurzem gibt es Anzeichen, dass mein Vater doch, entgegen seinen Behauptungen als Zeuge in SS-Prozessen, bei mindestens einer der Massenerschießungen 1941 in der Ukraine dabei war.
Ich weiß noch nicht, was ich mit dieser neuen Information anfange. Doch weiß ich, dass das Gespräch mit Jean-Michel Gaussot, mit Yvonne Cossu-Alba, Tochter eines in Sandbostel umgekommenen französischen Häftlings, und anderen Betroffenen der zweiten und dritten Generation die Chance bietet, gemeinsam neue Wege im Umgang mit dieser nicht enden wollenden Vergangenheit zu suchen.

Barbara Brix et Yvonne Cossu-Alba en Mai 2015. © KZ-Gedenkstätte Neuengamme 2015.