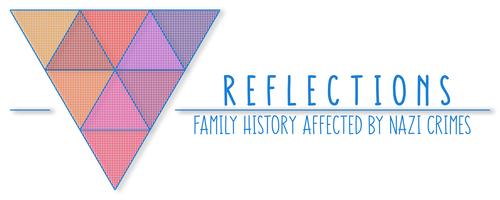Der Dialog zwischen Angehörigen ehemaliger KZ-Häftlinge und Angehörigen von NS-Tätern bringt Menschen zusammen mit ganz unterschiedlichen Familiengeschichten. Sie können sich wirklich kennenlernen, Beziehungen zueinander aufbauen und, idealerweise, auch gemeinsam außerhalb des Rahmens der Dialoggruppe aktiv werden. Es besteht aber auch immer die Möglichkeit, dass es zu Konflikten und Verletzungen kommt.
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forums „Zukunft der Erinnerung“ überwogen scheinbar die positiven Seiten. Die Mehrheit von ihnen bat am Workshop „Dialog zwischen Angehörigen ehemaliger KZ-Häftlinge und Angehörigen von NS-Tätern“ teilnehmen zu dürfen.
Hier führen wir vier Gründe auf, warum es ein positives Zeichen für die Zukunft der Erinnerung ist, dass sich dieser Workshop also so beliebt erwies.
1. Man lebt bereits gemeinsam ohne es zu bemerken
Angehörige ehemaliger KZ-Häftlinge und Angehörige von NS-Tätern leben in unmittelbarer Nachbarschaft von einander – mit Ausnahme vielleicht von denen, die ihre Heimat in Israel haben. Sie begegnen sich auf der Straße, im Bus oder Theater. Nur wissen sie gewöhnlich nichts von der Geschichte des anderen.
Zu Beginn des Dialogs steht also auch ein Bekenntnis zur eigenen Familiengeschichte vor zunächst Fremden. Dadurch geben die Beteiligten ein Stück Anonymität auf, die Auswirkungen der Verbrechen der Nazis bekommen dadurch aber ein Gesicht. Gemeinsam setzen sie ein Zeichen gegen die Historisierung und Entpersonalisierung gesetzt.
2. Interesse und Respekt
Ein Dialogtreffen unterscheidet sich in wichtigen Punkten von einer zufälligen Thematisierung der eigenen Familiengeschichte. Hier muss kein Beteiligter fürchten, auf Desinteresse an der Geschichte des Nationalsozialismus bei seinem Gegenüber zu treffen. Durch gewisse, von allen Teilnehmenden bestimmte Regeln wird der Dialog in eine konstruktive Richtung gelenkt. Ein Beispiel hierfür sind die Vereinbarungen und Regeln der Sonntagstreffen von One by One Deutschland.
3. Geerbte Schuld, geerbtes Leid?
Der Dialog ermöglicht es den Teilnehmenden, zu verstehen, dass sowohl die Anwendung von Gewalt als auch die Erfahrung von Gewalt durch die Verwandten Einfluss auf das Leben der einzelnen Dialogteilnehmerinnen und –teilnehmer hat. Hierbei geht es jedoch keinesfalls darum, Erfahrungen von Opfer- und Täterfamilien gleichzusetzen. Es geht vielmehr um die Erfahrungen und die Gefühle, die ein Mensch mitbringt. Allein durch die Teilnahme am Dialog setzen alle ein Zeichen. Unabhängig von dem Erbe, das sie geprägt hat, entscheiden sie sich gegen ein „Schubladendenken“ und für die Wertschätzung der Entscheidungen des Individuums. Sie sehen in einander weder Opfer noch Täter qua Familiengzugehörigkeit, sondern selbstständig handelnde Menschen.
4. Zukunftsorientierung
Bereits während der Mehrgenerationenbegegnung im Mai 2014 in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, auf der 40 Personen aus vier Generationen, darunter Überlebende der Konzentrationslager, ihre Angehörigen sowie Jugendliche aus Deutschland und Gedenkstättenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die zukünftige Wahrung der Erinnerung und des Gedenkens an die ehemaligen Häftlinge diskutierten, wurde eine Erklärung formuliert, die die zukunftsorientierten Motivation für einen Dialog betont:
Die Kinder von Tätern und die Kinder von KZ-Häftlingen […] können und sollten gemeinsam handeln, damit die Verbrechen, die ihre Eltern verübt haben oder erleiden mussten, sich nicht wiederholen.
Der Dialog bringt also Menschen zusammen, die sich gemeinsam dafür einsetzen wollen, dass die Menschenrechte gewahrt werden und die Menschen einander mit Respekt begegnen. Diesem Ziel kann sich z.B. durch gemeinsame öffentliche Auftritte angenähert werden, die zeigen, dass die Angehörigen nun Brücken schlagen. Die Schulbesuche von One by One Deutschland. Angehörige ehemaliger KZ-Häftlinge und Angehörige von Tätern besuchen gemeinsam Schulklassen. Die Sprecher gewähren persönliche Eindrücke und tragen dadurch zu einer Enthistorisierung bei. Schließlich werden die Schülerinnen und Schüler angeregt, gegenwärtige Formen von Ausgrenzung und Hass zu erkennen und sich mit der Frage zu befassen, wie sie sich diesem entgegen stellen können.
Haben Sie auch Interesse an der Teilnahme an einem Dialogtreffen? Dann möchten wir Ihnen hier einige Projekte und Veranstaltungen vorstellen:
Veranstaltungen und Projekte
One by One Deutschland veranstaltet vier Mal im Jahr offene Sonntagstreffen von 16-19 Uhr in der Galerie in der Fehrbelliner Straße 92, 10119 Berlin-Prenzlauer Berg. Hier finden Sie die Termine für die Treffen.
Vom 4.-8. Dezember 2015 findet in Wien das Symposium „Wege aus der ‚Last des Schweigens‘ 20 Jahre TAE“ statt.
In Kürze werden wir Sie auf diesem Blog auch über das für das erste Halbjahr 2016 in Hamburg geplante Dialogseminar informieren. Wollen Sie diese Ankündigung nicht verpassen? Melden Sie sich einfach zu unserem kostenlosen Newsletter an: