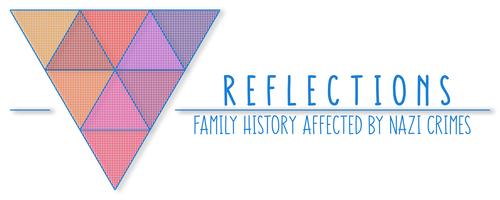Die Erforschung der Geschichte meiner Familie war für mich schockierend und „schwer verdaubar“, letztendlich für mich und einige meiner Nichten und Neffen aber erklärend und reinigend. Für andere Familienmitglieder war sie schändlich und „Staub-aufwirbelnd“. Sie waren gegen eine Veröffentlichung der Familienbiografie und wollten sie verhindern.
Die „asoziale“ Familie
Ich bin das jüngste und das einzige noch lebende der 10 Kinder meines Vaters. Ich habe keine Kinder, dafür waren meine Geschwister „fleißig“, denn ich bin 40-facher Onkel, 53 mal Großonkel, 22 mal Urgroßonkel und 2 mal Ur-Ur-Großonkel. 1
Mein Vater wurde 1900 in Kaiserslautern als Sohn eines Schneiders geboren. 1923/24 war er als Pfälzer Separatist aktiv und in einer Gestapo-Akte wird er als „Reichsbannermann“ bezeichnet. Er heiratete 1925 die Tochter eines Zimmermanns und zeugte mit ihr 8 Kinder, wovon 1 Kind nur 4 Monate alt wurde.
Die Familie lebte in sehr prekären Wohnverhältnissen. Ende der 1920er und in den 1930er Jahren war mein Vater Gelegenheitsarbeiter und oft arbeitslos.
Aufgrund der sozialen Situation und der früheren politischen Tätigkeit meines Vaters wurden die Familienmitglieder entsprechend der rassenhygienischen Ideologie als „asoziale Volksschädlinge, moralisch minderwertig und angeboren schwachsinnig” behandelt. So spricht das Vormundschaftsgericht im Juli 1938 noch von der „Pflicht der armenrechtlichen Fürsorge helfend einzugreifen“. 2 Demgegenüber sind für das Amt für Volkswohlfahrt der NSDAP (NSV) die „Not und Armut lediglich die Folgen nicht aber die Ursache. Ursache ist ausschließlich die moralische Minderwertigkeit beider Eheleute.“ 3 Die Polizei stellt dazu fest: „Der Ehemann Ims hat sich während der Separatistenzeit aktiv beteiligt, weshalb er die Voraussetzungen für die Gewährung der einmaligen Kinderbeihilfe in politischer Hinsicht nicht erfüllte. […] Seine Ehefrau ist geistig minderwertig. Sie wurde 1937 zur Verhütung erbkranken Nachwuchses sterilisiert, womit die Familie das Anrecht auf Zuwendung laufender Kinderzulage verlor“4. Die politische Logik dieser Verweigerung von Sozialleistungen zeigt eine Rede des Reichsinnenministers Dr. Wilhelm Frick vom 28. Juni 1933:
Was wir bisher ausgebaut haben, ist also eine übertriebene Personenhygiene und Fürsorge für das Einzelindividuum ohne Rücksicht auf die Erkenntnisse der Vererbungslehre, der Lebensauslese und der Rassenhygiene. Diese Art moderner ‘Humanität’ und sozialer Fürsorge für das kranke, schwache und minderwertige Individuum muß sich für das Volk im Großen gesehen als größte Grausamkeit auswirken und schließlich zu seinem Untergang führen.5
Die Konsequenzen der Einstufung als „moralisch minderwertig“ gingen aber über die Kürzung von Sozialleistungen weit hinaus. So kamen 1938/1939 die Kinder auf Beschluss des Vormundschaftsgerichts in Fürsorgeerziehung. Dort wurden die beiden jüngsten Brüder Grenzfälle der „Euthanasie“6 und für die damals 15-jährige älteste Schwester hielt es die Fürsorgeanstalt für ihre „Pflicht, dem Amt nahezulegen, die Frage der Unfruchtbarmachung zu prüfen“7. 1943 starb die Frau meines Vaters. Er heiratete 1944 meine Mutter, eine 33-jährige, ledige Frau, die seit Geburt mit einem schiefen Mund und einem zugewachsenen Ohr gezeichnet ist. Sie lebt mit der Angst, dass die Nazis sie wegen dieser Missbildungen töten (mit ihren Worten: „Ich hatte Angst, dass die Nazis mich wegmachen“). Sie hat seit über fünf Jahren das kleinbürgerliche Elternhaus verlassen und arbeitet seither als Magd („Hausgehilfin“) auf verschiedenen Weingütern in der Pfalz. Sie lernt einen zehn Jahre älteren Witwer kennen, der als „moralisch minderwertig“ von den Nazis stigmatisiert wird, als Knecht auf Weingütern arbeitet und dessen Frau wegen Schwachsinn sterilisiert wurde. Sie vollzieht einen sozialen Abstieg, indem sie ihre Stelle aufgibt und in die Wohnung des mittlerweile zur Wehrmacht eingezogenen Soldaten einzieht. Die Wohnung liegt in einem Stadtteil, das als das schlimmste „Asozialen-Viertel“ Kaiserslauterns bekannt und berüchtigt ist. Es ist die Zeit der schlimmsten Kriegsjahre, als sie sich der sieben angeheirateten Kinder annimmt, wovon der Älteste nur 14 Jahre jünger ist als sie, der zweitälteste bei den Großeltern lebt und die fünf jüngsten sich wegen Verwahrlosung in Fürsorgeerziehung befinden.

© Ims
Meine Mutter wird diese Art des sozialen Umfelds erst 20 Jahre später verlassen. Ihr Wesen war geprägt von Verantwortungsbewusstsein, Rechtschaffenheit, Selbstachtung, Sauberkeit und Fürsorge. Diese Werte bewahrten sie vor der in diesem Milieu oft vorhandenen Resignation. Sie wird sie nicht nur nicht verlieren, sondern versuchen, sie an ihre und die Kinder ihres Mannes weiterzugeben. In einigen Fällen wird ihr dies nicht gelingen.
Von einem Teil der Familie meines Vaters wurde sie „geschnitten“. So war sie für eine ihrer Schwägerinnen wegen ihres schiefen Mundes das „Schäpmaul“, mit dem sie nichts zu tun haben wollte.
Meine Mutter hatte aber auch „politische“ Probleme, da sie einen moralisch minderwertigen Asozialen geheiratet hatte und dadurch für die Nazi-Rassisten selbst zur „Asozialen“ wurde. Sehr pointiert formuliert dies der Rassenpolitiker Dr. Walter Groß:
Der asoziale Personenkreis ist ein typisch biologisch umschriebener Personenkreis mit charakteristischen erblichen Merkmalen und mit der Tendenz immer seinesgleichen als Partner, als Sexual- und Zeugungspartner zu suchen. […] Eine anständige und auch nur durchschnittlich brauchbare und tüchtige Frau verbündet sich nicht mit einem charakteristisch Asozialen.8
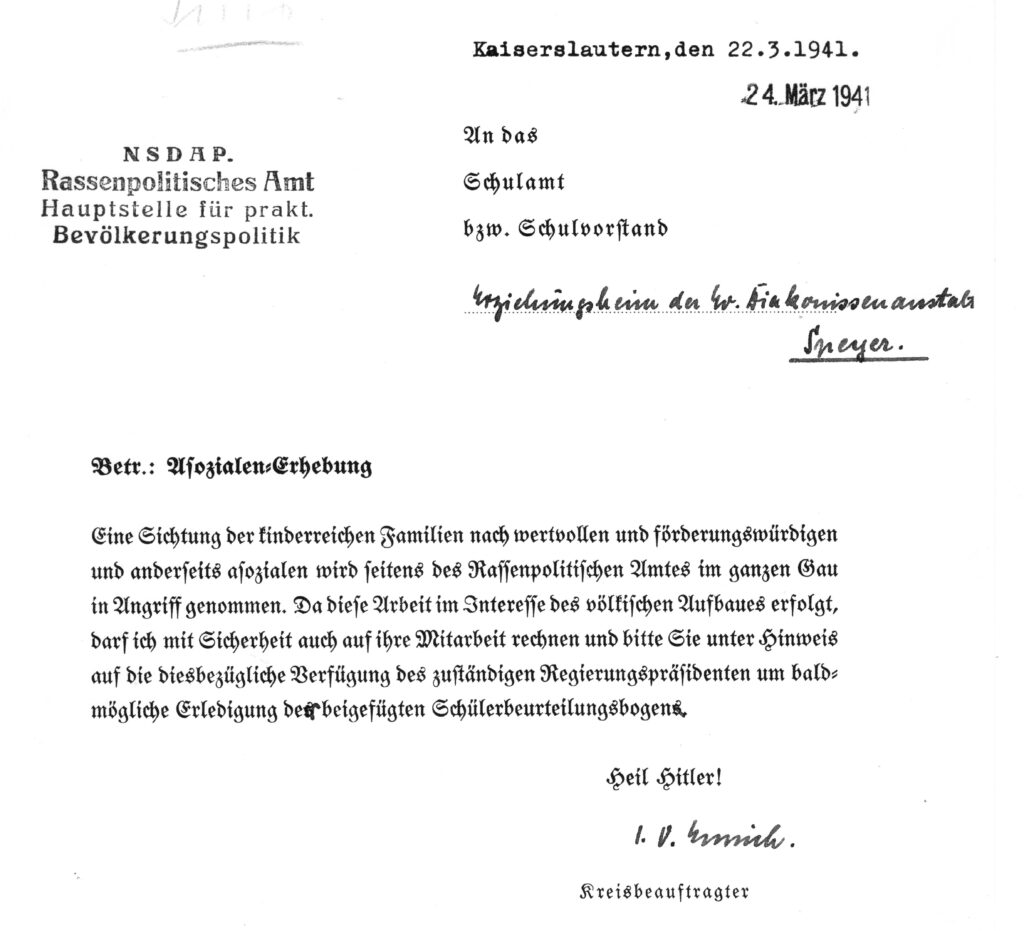
© Zentralarchiv der Pfalz in Speyer
Trotz aller Widrigkeiten sieht sie es aufgrund ihrer sozialen Einstellung und ihres Selbstverständnisses als ihre moralische Pflicht an, die Verantwortung für die Kinder ihres Mannes zu übernehmen. Gleich nach der Heirat begann der Kampf meiner Mutter mit den Ämtern, um ihre (Stief-) Kinder aus dem Heim bzw. der Anstalt zu holen. Den ersten Erfolg hatte sie bereits nach 4 Monaten: Zwei Mädchen wurden aus der „Fürsorgeerziehung“ entlassen und kamen nach Hause. Im Juni 1945, zwei Monate nach Kriegsende, kam mein ältester Bruder nach Hause: Er war nur acht Wochen in Fürsorgeerziehung und hatte anschließend sechs Jahre für einen Ortsbauernführer, seinem amtlich bestellten Pflegevater, gearbeitet. Meine älteste Schwester wurde 1946 aus der „Fürsorgeerziehung“ entlassen und 1951, nach sieben Jahren Kampf meiner Mutter mit den Ämtern, hat meine Mutter die beiden Jüngsten von ihrem ersten „Heimaturlaub“ gegen den Rat der Ärzte nicht mehr in die Anstalt zurückgehen lassen. 6 ½ Jahre nach Ende des Tausendjährigen Reichs waren alle Kinder wieder „Zuhause“.
Im Jahr 1947 wurde meine Schwester und 1949 wurde ich geboren. Wir beide sind somit nur mittelbar von der Rassenhygiene (ein fürchterliches Wort) der Nazis betroffen.
Die Bilanz der Rassenhygiene
Mit der (inoffiziellen) Entlassung der Zwillingsbrüder haben im Dezember 1951 die direkten Auswirkungen der Rassenhygiene der Nationalsozialisten auf die Familie ihr Ende gefunden.
Die (traurige) Bilanz:
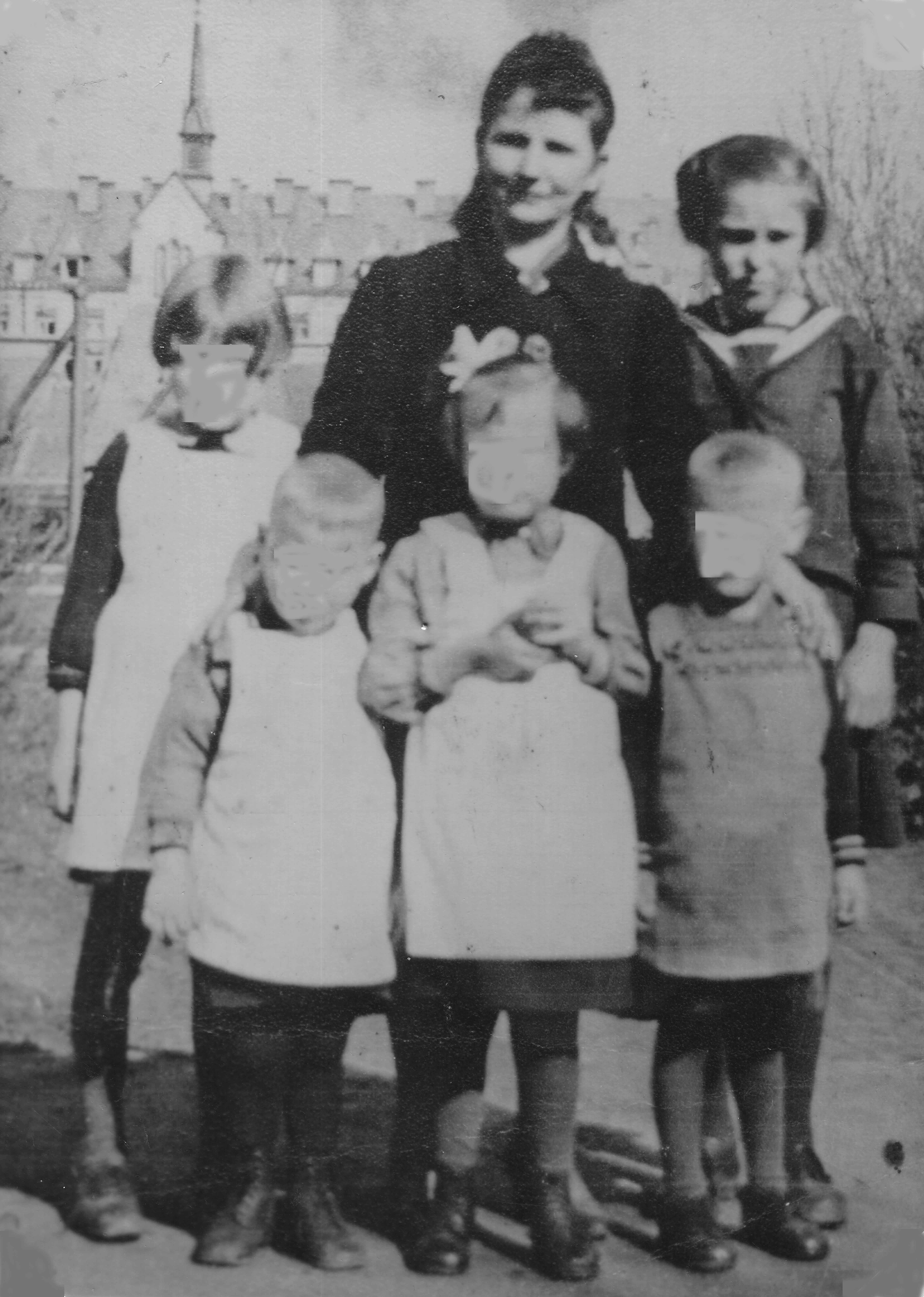
© Ims
- Die erste Frau meines Vaters ist eine der 400.000 Zwangssterilisierten,
- mein Vater ist als asozial und moralisch minderwertig stigmatisiert,
- die Familie lebt in einem „Asozialenviertel“,
- mein ältester Bruder arbeitete sechs Jahre unentgeltlich für einen Ortsbauernführer und Ortsgruppenleiter,
- mein zweitältester Bruder kam mit vier Wochen Jugenderziehungslager einigermaßen glimpflich davon,
- meine älteste Schwester ist als angeboren schwachsinnig stigmatisiert und wohl nur durch die Bombardierung von Frankenthal der Zwangssterilisation entronnen,
- die beiden jüngeren Schwestern hatten insofern Glück, als dass sie Dank meiner Mutter „nur“ fünf Jahre in der Fürsorgeerziehung waren,
- die 15-jährigen Zwillingsbrüder sind „fürsorglich erzogene Analphabeten“, als angeboren schwachsinnig stigmatisiert und durch die Bombardierung von Frankenthal höchstwahrscheinlich der Euthanasie entronnen,
- meine Mutter muss mit den langfristigen Folgen der „Fürsorgeerziehung“ der Kinder aus der ersten Ehe ihres Mannes zurechtkommen und kann in der Folgezeit im „Asozialenviertel“ von Kaiserslautern ihren eigenen Kindern keine vorteilhaften Startbedingungen bieten.
Die Zeit danach
Einige meiner Geschwister lebten bis zu ihrem Tod in prekären sprich „asozialen“ Verhältnissen. Ich wurde auf dem Kalkofen (Top-1 der berüchtigten sozialen Brennpunkte von Kaiserslautern) geboren und wuchs auf dem Engelshof (Top-2 der Liste9) auf, denn meine Eltern bekamen erst 1963 eine 2-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung in einem neu errichteten Sozialbau-Viertel.
Die „Entwicklung“ der Familie während der Nazizeit und unmittelbar danach war weder mir noch meiner Schwester oder meinen Nichten und Neffen bekannt. Folgt man Wolfgang Ayaß, so war dies kein Einzelfall. Er schreibt:
Das rigorose Vorgehen gegen „Asoziale“ wurde in der öffentlichen Meinung oft zu den positiven Seiten der Nazizeit gezählt. Menschen, die aus sozialen Gründen verfolgt worden waren, verschweigen dies daher oft sogar gegenüber ihren nächsten Angehörigen.10
In meiner Familie war das Verschweigen recht einfach, denn es gab niemand, der bzw. die die Entwicklung in einem politischen Kontext gesehen hat. Jedenfalls habe ich nie erlebt, dass darüber gesprochen wurde. Die Nazizeit war nie Thema und auf die Frage einer meiner Nichten an ihren Vater: „Warum kannst Du nicht lesen und nicht schreiben?“ bekam sie nur die Antwort: „Das willst Du gar nicht wissen!“
Mein Vater starb 1978 und meine Mutter 1984; auch sind all meine Geschwister gestorben, so dass Antworten nur noch in Akten gefunden werden können, die allerdings in der die Menschenwürde verachtenden Sprache der Täter geschrieben sind.
Die Aufarbeitung
2005 begann ich (56-jährig) mit Familienforschung. Ausgangspunkt waren einige wenige Geburts- und Sterbeurkunden meiner Großeltern, die meine Mutter bei ihrer Heirat 1944 zum Ariernachweis brauchte.
Im Mai 2012 bekam ich vom Stadtarchiv Kaiserslautern die Einwohnermeldekarte meines Vaters. Hierin ist vermerkt, dass meine älteste Schwester 1938 und fünf weitere Kinder 1939 nach Speyer in die Diakon. Anst. verzogen sind. Dies war für mich der erste Hinweis, in welchem Heim die Kinder waren und der Beginn der Erforschung der Geschichte meiner Geschwister.
Ich wusste nur, sie waren im Heim, denn als Kind wurde mir zu Hause folgende Legende erzählt: Mein Vater wurde zum Krieg eingezogen, seine Frau ist gestorben und seine Kinder kamen ins Heim. Mein Vater hat meine Mutter geheiratet und sie hat die Kinder aus den Heimen heimgeholt. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals Einzelheiten hierzu zur Sprache kamen.
Wie jede Legende, so beinhaltet auch diese ein Körnchen Wahrheit, denn die Ereignisse stimmen, aber sie erfolgten in einer anderen Reihenfolge, was ein gewaltiger Unterschied ist: Erst kamen die Kinder ins Heim, dann verstarb die Mutter und zuletzt wurde mein Vater zur Wehrmacht eingezogen.
Unklar bleibt, was meine Mutter von der Vorgeschichte wusste. Ob ihr die korrekte Chronologie damals bewusst war, beziehungsweise ob es sich bei dieser Legende um eine Geschichtsglättung handelt, wie sie in vielen Familien für die Situation in der damals schweren Zeit fast schon üblich war?
Diese Version der Geschichte ist ja Ausdruck einer zwar bedauerlichen aber sozial intakten Situation. Daher erübrigt sich die Frage nach den Gründen, warum die Kinder ins Heim kamen. Jedenfalls musste man mit dieser Version der Geschichte nicht die elenden Zustände in der Familie sowie die Erziehungsleistung der Eltern hinterfragen, die die Schulbehörden und das Jugendamt auf den Plan riefen. Und man umging Fragen nach der politischen Gewichtung seitens der Nationalsozialisten und Diskussionen um die moralische Minderwertigkeit und den asozialen Charakter der Familie.
Mit den Akten des Vormundschaftsgerichts Kaiserslautern, die ich 2016 bekam, konnte ich die Entwicklung der Familie (aus Amtssicht) rekonstruieren und die Familienbiografie dokumentieren.
Je mehr Details ans Licht kamen und ich diese in der Familie kommunizierte, umso mehr spaltete sich die Familie.
Ich habe nicht zu allen meiner Nichten und Neffen und deren Kindern Kontakt. Manche verweigern sich und zu anderen fällt es mir schwer, einen Kontakt aufzubauen bzw. aufrecht zu erhalten.
Diejenigen, mit denen ich Kontakt habe und die von dieser Dokumentation wissen, teilen sich in die Gruppen derer, die die Aufarbeitung begrüßen und auch gut finden und in solche, die der Publikation eher skeptisch oder sogar ablehnend gegenüberstehen.
Akzeptanz der Aufarbeitung
Für diejenigen, die der Offenlegung der Ereignisse positiv gegenüberstehen, freue ich mich, dass sie die Berührungskraft11 besitzen, sich mit der Vergangenheit unserer Familie zu beschäftigen. Ich bin ihnen dankbar für das Verständnis und die Unterstützung. Ihre Haltung zeigt, dass die Dokumentation hilft, unsere Familie (und sich selbst) besser zu verstehen12.
Einige ziehen Stolz aus der Tatsache, trotz der widrigen Umstände es geschafft zu haben, dem Milieu zu entkommen.
Die eher skeptischen Personen scheuen sich, schwer Ertragbares wahrnehmen zu müssen. Sie besitzen diese Berührungskraft nicht und wollen sich nicht „mit dieser schlimmen Zeit“13 auseinandersetzen.
Widerstand gegen die Aufarbeitung
Unter denen, die die Publikation ablehnen, gibt es welche, die gar nicht wissen, was sie ablehnen. Sie wissen von der „asozialen“ Nazi-Vergangenheit nichts und wollen auch nichts davon wissen.
Bei denen, die die Vergangenheit und den Nazi-Kontext kennen und die Veröffentlichung dennoch verhindern wollten, stellt sich die Frage, worauf sich dieser Widerstand gründet.
Beispielhafte Reaktionen:
Eine Nichte war empört und wütend, als ich ihr aus den Akten vorlas, dass (aus Sicht der Nazis) ihre Oma die Kinder und damit auch ihren Vater vernachlässigt und „verwahrlosen“ hat lassen.
Als ich erwähnte, dass die Geschichte publiziert werden soll, meinte eine Schwägerin spontan: „Aber doch sicher ohne Namen, wenn das die Nachbarn lesen würden …“.
Und die Nichte, die ihren Vater obige Frage stellte und mit den Akten genau belegt und begründet bekommt, warum ihr Vater Analphabet war, will nicht, dass dies so offengelegt wird. Ihre Töchter sollen von ihrem Opa ein „positives“ Bild haben. Und es muss doch nicht alles so genau benannt werden, das stellt einen doch total „bloß“, das macht einen doch völlig „nackt“.
Das Problem der Scham
Die Scham, die hier zutage tritt, ist individualistisch, sie ist nicht Teil der Schuld- und Schamgefühle im Zusammenhang mit dem emotionalen Verhältnis der Deutschen zu den Verbrechen der NS-Zeit, insbesondere dem Holocaust. Sie hat mehr mit dem zu tun, was Frank Nonnenmacher in einem Interview im Zusammenhang mit dem Antrag im Deutschen Bundestag zur Anerkennung der „Asozialen“ und „Berufsverbrecher“ als Opfer des Nationalsozialismus beschreibt:
Schwarz- und Grünwinkligen als Opfergruppen anzuerkennen wäre nach 70-jährigem Schweigen ein so wichtiges Signal, es würde sie in die Reihe der Verfolgten des Nazi-Regimes stellen. Skandal genug, dass das für die direkt Betroffenen fast zu spät kommt. Für die Nachkommen, die bislang das schamhafte Schweigen fortgesetzt haben, bedeutet es aber eine Ermutigung sich mit ihrer Familiengeschichte unvoreingenommen zu beschäftigen. Und für unsere Erinnerungskultur könnte es eine Bereicherung sein, dass wir uns auch mit den verdrängten Seiten der Vergangenheit auseinandersetzen.14
Einige meiner Familienmitglieder haben Probleme, sich mit der Familiengeschichte unvoreingenommen zu beschäftigen. Für sie ist die Scham zu groß und die Geschichte soll weiter unter dem Teppich bleiben.
Die Familie meines Vaters war ein Sozialfall und einige seiner Nachkommen sind immer noch oder wieder Sozialfälle. Hier könnte sich die Scham auf das (selbst verschuldete!?) Scheitern beziehen, es nicht geschafft zu haben, dem Milieu zu entkommen.
Es sind aber gerade diejenigen, die es geschafft haben, keine Sozialfälle zu sein, die die stärkste Ablehnung zeigen. Eventuell liegt dies daran, dass sie glauben etwas (z.B. ihren guten Ruf) zu verlieren, denn die Scham bezieht sich hier nicht auf eigene Fehltritte oder das Scheitern an gesetzten Zielen bzw. Erwartungen. Sie fühlen sich durch die Veröffentlichung der Missstände bloßgestellt und bangen um ihren Platz in ihrer Welt.
Nun gibt es nur Wahrnehmung, keine „Falschnehmung“; aber gibt es ein „Falschfühlen“? Wir nehmen unsere Gefühle wahr – können wir sie auch „falschnehmen“? Ist Scham im vorliegenden Fall ein taugliches Konzept, um zu verstehen, warum tabuisiert und verdrängt wird oder verschleiert der Begriff mehr als er benennt15?
Scham – ein trojanisches Pferd
Wir schämen uns, weil wir negative Reaktionen unseres Umfelds befürchten. Diese Reaktionen hängen stark von den kulturellen Wertevorstellungen der Gruppe ab, der wir uns zugehörig fühlen.
Aber “Scham […] ignoriert die gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen, [sie] dethematisiert die Verhältnisse, die die Scham hervorrufen“16. So wird in keiner der oben beschriebenen Reaktionen in meiner Familie in Betracht gezogen, wie es dazu kam, dass die Familie meines Vaters so lebte, wie sie lebte. Es wird auch nicht hinterfragt, welche Konsequenzen die Familie durch die „Asozialen“-Politik der Nazis ertragen musste.
Das Problem geht aber über das Nichthinterfragen hinaus. Wenn sich meine Nichte schämt, weil ihr Opa von den Nazis als „asozial“ und „moralisch minderwertig“ angesehen und behandelt wurde, dass ihr Vater bereits im Alter von fünf Jahren als „angeboren schwachsinnig“ galt, ihm deshalb eine Schulbildung verweigert wurde und mit 15 Jahren ein „fürsorglich erzogener Analphabet“ war, worauf bezieht sich dann die Scham?
Bezieht sie sich als Fremdschämen auf die Nazis und deren menschenverachtende „Asozialen“-Politik? Das wäre, äußerst zurückhaltend formuliert, fehl am Platz. Hier wäre zumindest ein Gefühl von Empörung wesentlich angebrachter.
Oder bezieht sie sich auf den „asozialen“ Opa bzw. „angeboren schwachsinnigen“ Vater? Dann verschieben sich aber nicht nur – siehe oben – die Begründungszusammenhänge, sondern es werden die Normvorstellungen der Nazis übernommen, die sich wie die griechischen Soldaten im trojanischen Pferd als „dunkle Geister“ hinter der Scham verstecken.
Des Weiteren trägt die Übernahme der Begrifflichkeit „asozial“ und der damit verknüpften Ausgrenzung zum Fortbestand der Diskriminierung der „Asozialen“ bei, eben weil weder die soziale Ausgrenzung noch die menschenverachtende „Asozialen“-Politik“ der Nazis thematisiert noch nicht einmal gedacht wird.17
Für die Gegenwart heißt dieses unter den Teppich kehren genau den Freiraum zu schaffen, in dem sich das menschenverachtende Denken der Täter wieder breit machen kann. Es schafft den Freiraum für die Trivialisierung18 der NS-Barbarei, die sich nicht nur in dem „Vogelschiss“-Begriff von Alexander Gauland äußert, sondern beispielsweise auch, wenn auf Querdenken-Demonstrationen – dem Judenstern gleich – ein Ungeimpft-Abzeichen zur Schau gestellt oder der Widerstand gegen die „Corona-Diktatur“ mit dem antifaschistischen Kampf von Sophie Scholl gleichgesetzt wird.
Es wird aber nicht nur dieser Freiraum geschaffen, sondern die Diskriminierung wird fortgeführt, da das Bild des Nicht-Normalen, des Nicht-Angepassten der „Asozialen“ aufrechterhalten wird.
Äußerst problematisch wird es, wenn mit Scham der Grundgedanke bewusst verdeckt werden soll, dass „Asoziale“ keine Opfer waren (oder sind), weil mit diesen „Sozialschmarotzern“ damals „richtig umgegangen wurde“. So könnte man doch auch heutzutage mit den „arbeitsscheuen Hartz-4lern“ umgehen und die öffentliche Empörung kann sich in Grenzen halten, wenn ein Obdachloser im Schlaf auf einer Parkbank mit Benzin übergossen und angezündet wird.
Epilog
Mein Anliegen ist es nicht, die Familie meines Vaters wehleidig als „NS-Opfer“ zu beschreiben oder die Lebensweise meines Vaters und seiner ersten Frau zu verteidigen, zu rechtfertigen oder anzuprangern.
Mein (politisches) Anliegen besteht darin, zu dokumentieren, dass die rassenhygienische Politik der Nazis gegenüber Menschen, die sie als Asoziale brandmarkten, Unrecht war. Ich wehre mich dagegen, dass in unserer Gesellschaft nach wie vor Menschen aufgrund ihrer sozialen oder wirtschaftlichen Situation bzw. ihres „unangepassten“ Lebenswandels diskriminiert werden.
Dass ich mich dabei als Sohn eines „asozialen“ Vaters oute, ruft bei mir keine Scham hervor. Denn er war nach der sozialrassistischen Ideologie der Nazis „asozial“ und um diese Ideologie zu vertreten, bedarf es bei mir, mit Gruß an Bernd Höcke, einer politischen 180°-Wende.
Nach der eugenischen Ideologie der Nazis war Asozialität erblich. Welche aberwitzig-absurde Logik dies beinhaltet, zeigt mein Lieblingszitat der Rassenhygiene, wonach ich gar nicht Sohn meines Vaters bin:
Einzelne sozial brauchbare Kinder aus „asozialen Großfamilien“ sind folgerichtig nichts anderes als ein Hinweis auf Seitensprünge der Mutter.19
- Meine Familie ist etwas „unübersichtlich“, daher können die Zahlen auch größer sein.↑
- Landesarchiv Speyer – LASp. 120, Nr.3497, XII 176/38 Blatt 5↑
- Ebenda Blatt 22 ↑
- Ebenda Blatt 10 ↑
- Auf der ersten Sitzung des Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik (Berlin, 28. Juni 1933) – Zitiert nach Ayaß, Wolfgang, „Gemeinschaftsfremde“, Quellen zur Verfolgung von „Asozialen“ 1933 – 1945, Materialien aus dem Bundesarchiv, Heft 5, Bundesarchiv Koblenz 1998, Dokument 5 ↑
- Die Zwillinge waren bei der Einlieferung zur Fürsorgeerziehung sie 2 Jahre und 2 Monate alt. Als sie knapp 5 Jahre alt waren, schrieb die Fürsorgeanstalt: Die Kinder sind typische Zerstörer und Unruhestifter. … Es handelt sich um Schwachsinnige. … Wir bitten das . Amt, die Frage zu prüfen, ob die beiden nicht .. in [der Heil- und Pflegeanstalt] Frankenthal untergebracht werden können. Eine andere passende Anstalt können wir zur Zeit nicht nennen, es sei denn die Heil-Erziehungsanstalt in Scheuern bei Nassau/Lahn. [Scheuern war Zwischenstation der Tötungsanstalt Hadamar]. ↑
- Diakonissen Speyer-Mannheim – DSM Nr. 4620 ↑
- Dr. Walter Groß, Leiter des Rassenpolitischen Amts des Gaus Oberdonau, Linz, 14. März 1940, zitiert aus: Ayaß W.: „Gemeinschaftsfremde“, Dokument 98. ↑
- vgl. Christian Baron: Ein Mann seiner Klasse, Berlin, 2020, S. 25 ↑
- Wolfgang Ayaß: „Asoziale“ im Nationalsozialismus, Stuttgart 1995, S. 47 ↑
- Den Begriff habe ich übernommen von Dr. Volkhard Knigge während eines Interview in der 3sat-Sendung Kulturzeit am 26.1.2018, 19:20 h. Vgl. Volkhard Knigge↑
- Zitat aus einer Nachricht einer Großnichte von mir vom 23.6.2022: „Danke für deine Arbeit, die du hier rein gesteckt hast und mir so zeigst, wo ich her komme und in welchen Verhältnissen meine Vorfahren aufwachsen mussten“. ↑
- Zitat einer Cousine mütterlicherseits. ↑
- Frank Nonnenmacher: Die Nazi-Narrative wirken fort, in: taz, 9.4.2019. Frank Nonnenmacher ist einer der Initiatoren der Anträge im Deutschen Bundestags vom Februar 2019 zur Anerkennung der Asozialen und Berufsverbrecher als Opfer des Nationalsozialismus und Autor der Doppelbiographie seines Vaters und seines Onkels: Du hattest es besser als ich. ISBN 978-3-88864-528-0↑
- Andreas Hechler: Diagnosen von Gewicht – Innerfamiliäre Folgen der Ermordung meiner als ›lebensunwert‹ diagnostizierten Urgroßmutter.↑
- vgl. Andreas Hechler, a.a.O.↑
- vgl. Andreas Hechler, a.a.O.↑
- Helmut Ortner schreibt in: „Volk im Wahn. Hitlers Deutsche oder Die Gegenwart der Vergangenheit.“ Edition Faust, 2022, von „Verflachung und Normalisierung“↑
- Rassentheoretiker Wolfgang Knorr zitiert nach Wolfgang Ayaß: „Asoziale“ im Nationalsozialismus, S. 133 ↑