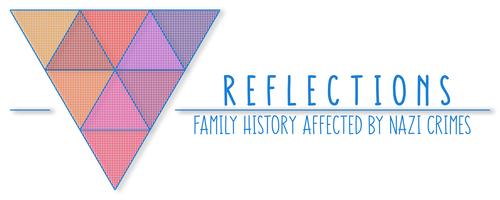Dieser Beitrag erschien zunächst bei ZEIT ONLINE am 27. Januar 2016.
Mein Vater wurde 1944 aus der Kleinstadt Satu-Mare in Transsylvanien nach Auschwitz und von dort ins Konzentrationslager Mauthausen deportiert. Seine Eltern konnten ihren Peinigern keinen wirtschaftlichen Nutzen bringen und wurden deshalb in die Gaskammer geschickt. Sie waren damals jünger, als ich es heute bin. Meine Mutter überlebte im Krieg als kleines Mädchen die Verfolgung durch das Horthy-Regime im Ghetto von Budapest.
Im Kreis meiner jüdischen Kindheitsfreunde in Wien war ich die Einzige, die eine noch lebende, im Übrigen heiß geliebte, Oma hatte. Sie erzählte mir unzählige Geschichten über ihren Leidensweg. Diese Berichte sowie ihre Albträume von ihren ermordeten Eltern, dem Ehemann und den Geschwistern waren Gutenachtgeschichten, mit denen ich als kleines Mädchen oft eingeschlafen bin. Dennoch ist die traurige Wahrheit, dass mir die zahlreichen ermordeten Angehörigen – trotz der großmütterlichen Schilderungen – fremd sind. Im Grunde genommen sind sie fast spurlos verschwunden. Ein Freund meiner Eltern merkte einmal über dieses Verschwinden der Vorfahren an: „Wie sollte ich meinen Kindern erklären, dass meine Frau und ich nicht Adam und Eva waren?“ Mit den Jahren verstehe ich seine Frage immer besser.
Die Geschichte meiner Familie bewog mich dazu, Wien zu verlassen und nach Israel einzuwandern. Nur allzu gut waren mir die täglichen Kaffeehausbesuche meines Vaters in Erinnerung, zu denen ich ihn oft, auch auf Kosten des Schulunterrichts, begleitet habe. Dort saß er mit seinen Freunden, die ausnahmslos Holocaustüberlebende waren. Ihre auf Jiddisch geführten Gespräche drehten sich, neben den praktischen Dingen des Lebens, um drei Themen: die Verbrechen der Tätergesellschaften Deutschland und Österreich, den damals (wie auch heute) aktuellen Antisemitismus und – gleichsam als Kontrast dazu – die Liebe zu Israel. Diese Kaffeehausrunden haben mich sehr geprägt. Denn ich hörte Menschen, die sich mit dem Land, in dem sie lebten, keineswegs identifizierten und von einem anderen, das sie durch eine rosarote Brille sahen, träumten. Sie hatten Familien, schöne Wohnungen, aber keine Heimat. Meiner Wahrnehmung nach lebten sie in einem Vakuum, das sie als ganz normal ansahen. Irgendwann wurde mir bewusst, dass ich nicht auch so leben wollte. Ich verstand, dass ich als Tochter von Holocaustüberlebenden emotional nicht fähig war und es auch nicht wirklich sein wollte, Österreich als meine Heimat anzusehen.
Mein Traum von der Zugehörigkeit zu einer Großfamilie erfüllte sich durch das Leben in der neuen Heimat: Ich heiratete in einen kinderreichen Clan ein. Obwohl ich schon lange Jahre geschieden bin, habe ich an der engen Verbundenheit zu dieser vielköpfigen, lauten, streitfreudigen und vitalen Verwandtschaft festgehalten, nicht nur wegen meiner beiden Kinder. Der Haviv-Stamm war und ist das Kontrastprogramm zum schwarzen Loch der Ermordeten und der traumatisierten Lebenden in meiner Familie. Meinen vor vier Jahren verstorbenen Schwiegervater löcherte ich oft mit Fragen nach der Geschichte seiner Familie in Libyen, der abenteuerlichen Flucht nach Israel und seiner Integration in die neue Heimat. Vielleicht wollte ich seine Stimme hören, weil mein eigener Vater nie über seine Jugend reden wollte. Erst bei unserer letzten Begegnung in Wien vor seinem Tod sagt er mir nebenbei: „Im Viehwaggon nach Auschwitz haben wir unseren eigenen Urin getrunken, um nicht zu verdursten.“
Seit ich im jüdischen Staat lebe, habe ich sowohl beruflich als auch privat immer die Nähe zu Überlebenden gesucht. Auf Hebräisch nennt man sie auch She’erit ha Plita, die letzten Entronnenen. 600.000 dieser Menschen sind seit der Gründung des Staates Israel 1948 eingewandert, weniger als ein Drittel von ihnen lebt heute noch. Viele von ihnen haben sich in Israel ein Stück jüdisches Europa erschaffen, nur dass vor ihrer Tür eben Palmen und keine Tannen stehen.
Der Dornbusch, der nicht verbrannte, ist der von der biblischen Metapher inspirierte Titel eines 2012 erschienenen Buches, das sich mit Überlebenden der Shoah und ihren Einfluss auf den Staat Israel und das Ethos der Gesellschaft befasst. „Überaus charakteristisch war der brennende Wunsch der Überlebenden, eine Rolle bei dem großen israelischen Drama zu spielen und zwar vorne auf der Bühne und nicht als Statisten“, bringt es die Schriftstellerin Nava Semel in ihrem Beitrag auf den Punkt.
Ich interviewte viele Entronnene, erarbeitete pädagogische Programme zu ihren Biografien und vor allem hörte ich ihnen einfach zu. Auch heute begegne ich ihnen immer wieder im Alltag. So stand ich kürzlich in einem Möbelgeschäft und wollte einen Schreibtisch erstehen. Meine lautstarken Verhandlungen mit dem Ladeninhaber wurden durch die Frage eines alten Herrn unterbrochen. Sein Hebräisch war eindeutig durch den mir so vertrauten ungarischen Akzent gefärbt. Sofort wandte ich mich vom erstaunten Verkäufer ab und fragte den Senior in seiner Muttersprache, woher er denn ursprünglich stamme. Daraufhin ließ auch er die Möbel Möbel sein und widmete sich mir. Er erzählte mir in wenigen Sätzen, dass er bis zu seiner Deportation nach Auschwitz in Budapest gelebt hatte und als einziger seiner Familie der Vernichtung entgangen war. Als Beweis zeigte er mir einen Ausweis mit seinem Foto. Die vom Finanzministerium ausgestellte Plastikkarte bescheinigte Eliezer, ein Überlebender der Shoah zu sein: „Invalide der Verfolgung durch die Nationalsozialisten“ hieß es dort wörtlich. Er erklärte mir, dass ihm dieses Dokument Anrecht auf Ermäßigungen und kostenlose psychologische Betreuung bei der Organisation Amcha gäbe.
Während unseres Gespräches stand seine Frau mit verschränkten Armen daneben und nickte nur. Ihr Gesichtsausdruck besagte: „Ich war auch dort, aber ich will darüber nicht reden, und stell mir ja keine Fragen“.
Ich erzählte dem alten Herrn, dass ich als Pädagogin versuche, deutsche Jugendliche für die Notwendigkeit des Gedenkens zu motivieren. Als er interessiert nachfragte, bat ich ihn, seine Karte fotografieren zu dürfen. Er zögerte einen Augenblick, dann hielt er sie mir hin. Während ich das Foto auf meinem Mobiltelefon begutachtete, holte er einen weiteren Ausweis hervor. „Kurz nach meiner Einwanderung musste ich im Unabhängigkeitskrieg kämpfen. Dort bin ich verwundet worden und seitdem bin ich auch Kriegsinvalide.“ In der Tat stand diese Information auf seiner zweiten Karte. Trotz der etwas widrigen Umstände – wir unterhielten uns immer noch über den Kopf des Möbelverkäufers hinweg – war ich auf den weiteren Verlauf von Eliezers Biografie gespannt. Doch ich spürte, dass der alte Mann ungeduldig wurde. Daher fragte ich rasch, ob ich auch diesen Ausweis fotografieren dürfe. Er blickte mich an, zögerte und erwiderte „Nein, das reicht“. Ich versuchte ihn nicht zu überreden, sondern dankte ihm für das Gespräch. Der Verkäufer atmete auf, er freute sich, dass wir wieder zur Tagesordnung überzugehen schienen. Den Schreibtisch habe ich allerdings nicht erworben.
Während ich das Foto des Ausweises betrachte, denke ich daran, wie sehr Israels Raison d’Être aus diesen beiden Dokumenten ersichtlich ist. Der alte Mann im Möbelgeschäft ist keineswegs ein Einzelfall. Nachdem den Entronnenen in Europa alles genommen worden war, wollten sie Israel um jeden Preis schützen. Sie kämpften nicht nur um das Land, sondern auch um eine neue Heimat, ein neues Leben. Das heutige Israel ist weit entfernt von den Idealvorstellungen des jüdischen Staates, die viele Entronnene beseelt hatten. Weder konnte es seinen Bürgern Frieden und Sicherheit gewährleisten, noch wurde es zu dem von seinen Gründern erträumtem Modell sozialer Gerechtigkeit, eher im Gegenteil. Doch eine Heimat und ein Zuhause hat es ihnen gegeben.
Für die meisten der Entronnen gilt nach wie vor das Bekenntnis einer Leidensgenossin zu ihrem Land: „Nach dem Krieg sind wir nach Israel eingewandert, nicht weil wir davon überzeugt waren, hier sicher zu sein. Wir sind gekommen, um nie wieder eine tolerierte oder auch nicht tolerierte Minderheit zu sein.“
Dieser Text entstammt der Sammlung „Zwischen allen Stühlen. Notizen aus dem israelischen Alltag“ der Bildungsexpertin, Autorin und Publizistin Anita Haviv-Horiner. Die Texte dieser Sammlung sind zwischen 2013 und 2020 entstanden und sollen einen Einblick in Israels tägliche Realität, wie die Autorin sie wahrnimmt, vermitteln.