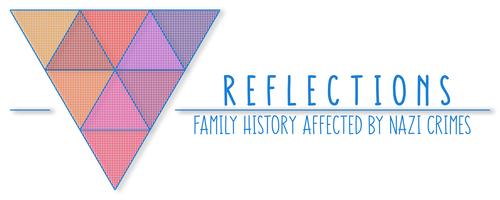Sind Sie Jüdin oder Deutsche?
Stille breitet sich aus unter den Gästen der Premiere des Dokumentarfilms L’Chaim – Auf das Leben! im Hamburger Abaton-Kino. Worauf will Chaim Lubelski, der Protagonist des Films, mit dieser Gegenfrage an eine Zuschauerin hinaus? Mehrmals holt die junge Frau tief Luft. Fast ein wenig trotzig antwortet sie schließlich: „Ich bin keine Jüdin.“ Mit hochgezogenen Schultern presst sie sich gegen die Rückenlehne des Kinosessels. Da beginnt Chaim Lubelski zu lachen.

Chaim und Nechama Lubelski.© mindjazz pictures – www.mindjazz-pictures.de
Auch im Film erklingt dieses Lachen oft. Es ist kehlig und glucksend zugleich. Entspannen kann sich die Zuschauerin immer noch nicht. Eigentlich hatte sie doch nur verstehen wollen, warum Chaim Lubelski und seine Mutter Nechuma, eine Holocaust-Überlebende, im Film Deutsch miteinander sprechen.
Nirgendwo richtig zu Hause sein
Chaim Lubelski zuckt leicht mit den Achseln. Vertreibung und Verfolgung gehören zu seiner Familiengeschichte. Nirgendwo lange bleiben, keine Heimat haben und immer wieder neue Sprachen lernen.
Die Entgegensetzung von Juden und Deutschen ist bei Chaim Lubelski nicht nur Provokation. Vielmehr will er damit sagen, dass nur Menschen, deren Familien auch Verfolgung erlebt haben, verstehen, was es bedeutet, dass die ermordeten Verwandten auch im Alltag immer präsent sind.
Meine ganze Einstellung zum Leben ist eigentlich sehr gut – im negativen Sinne
Chaim Lubelski hat nie lange an einem Ort gelebt. Dem schweren Erbe konnte er dennoch nicht entkommen. Selbst die Joints, die er regelmäßig auf dem Balkon oder am Fenster der Antwerpener Wohnung seiner Mutter raucht, schaffen es nicht, die Unruhe in ihm zu unterdrücken. Immer ist er in Bewegung. In einer Szene des Films schält er Gemüse für seine Mutter und drapiert einen sauren Hering auf ihrem Teller. Ein anderes Mal kocht er Tee. Als die polnische Haushaltshilfe seine Mutter auf einem der wenigen Spaziergänge stützt, scheucht Chaim sie weg. Er will mit seiner Mutter spazieren gehen. Nicht nur seine Mutter braucht ihn, sondern auch er benötigt die Aufgabe, sich um sie zu kümmern.
Die innere Unruhe ist es auch, die zwischen Chaim Lubelski und einer aussichtsreichen Laufbahn als Schachspieler gestanden hat. Chaim Lubelski habe sein Potential auf Grund des Traumas seiner Eltern nie voll ausschöpfen können, erklärt Elkan Spiller. Spiller ist nicht nur Regisseur des Films, sondern auch Chaim Lubelskis Cousin.

Regisseur Elkan Spiller. ©mindjazz pictures – www.mindjazz-pictures.de
Eine politische Botschaft
Elkan Spillers Vater ist der Bruder von Nechuma Lubelski. Auch er war im KZ. Der Film ist somit nicht nur das Portrait eines Mannes, der sich nicht um Konventionen schert, sondern auch Spillers Suche nach seiner eigenen Identität. So ist ihm auch daran gelegen, dass der Zuschauer zwei Erkenntnisse aus dem Kinosaal mitnimmt. Chaim Lubelski und er sowie alle anderen Kinder von Holocaust-Überlebenden sind gezeichnet von den Erfahrungen ihrer Eltern. Die Vererbung des Traumas geschieht aber auch in allen anderen Familien, die Krieg und Terror durchlitten haben.
Außergewöhnlich und doch wie wie wir alle
Diese Interpretationshilfe unterstreicht die Relevanz des Films. Dennoch liegt die wahre Stärke des Films in den Szenen, in denen die Kamera nur beobachtet und Elkan Spiller keine Fragen stellt. In diesen Momenten geht es um den Menschen Chaim Lubelski, nicht das Opfer des geerbten Leids.
Chaim Lubelski schiebt seine im Rollstuhl sitzende Mutter in einem Park. Sie ist bereits so schwach, dass sie sich nicht mehr die Haare färben lässt. Es ist ein sonniger Tag. Kinder spielen auf dem Spielplatz. Er massiert ihr die Schultern. Sie summt ein fröhliches Lied. Vielleicht ist es wieder „Wien, Wien, nur Du allein!“ Dieses Lied hat Nechuma Lubelski schon in einer früheren Szene gesungen. Es erinnerte sie an ihre eigene Mutter, die von den Nazis ermordet wurde. Ihr Sohn stimmt in das Summen mit ein.
Deutlich spürt man die Liebe, die diese beiden Menschen verbindet. Ein Liebe, die universell ist. Erwachsene Kinder und ihre Eltern überall auf der Welt verspüren sie für einander. Nein, um die Dichotomie von Juden und Nichtjuden geht es in dieser Dokumentation nicht. Es geht um das Leben. Trotz und wegen alledem. „L’Chaim!“
„L’Chaim – Auf das Leben!“ läuft seit 27. August 2015 in deutschen Kinos. Hier finden Sie die Vorstellungstermine.