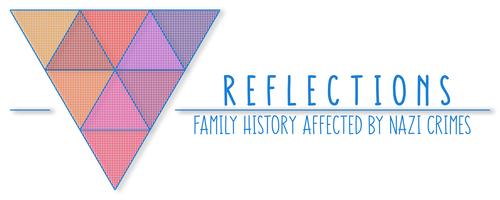Als Wissenschaftlerin für Oral History und Gedächtnisforschung in Polen habe ich jahrelang die Aussagen von Überlebenden des Zweiten Weltkriegs aufgezeichnet und ausgewertet. Die Erinnerung und die Erfahrungen der zweiten Generation, die im Schatten der traumatischen Vergangenheit aufgewachsen ist, wurden zum Thema meiner Doktorarbeit in Soziologie.
Der polnische Kontext
Im Gegensatz zum westlichen Kontext ist die Auseinandersetzung mit der kriegsbezogenen Postmemory (ein von der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Marianne Hirsch entwickeltes Konzept, das die Übertragung von Gedächtnisinhalten an zeitlich entfernte Personen oder Gruppen beschreibt) in Polen relativ neu. Daher gibt es nicht viele Dokumentationsprojekte, die sich mit den Nachkomm:innen der Überlebenden befassen, ganz zu schweigen von der dritten oder vierten Generation[1]. Es ist erwähnenswert, dass auch die in Polen befindlichen Gedenkstätten der nationalsozialistischen Konzentrationslager noch kein besonderes Interesse an diesem Thema zu haben scheinen. Wenn überhaupt einschlägige Dokumentations- oder Vernetzungsprojekte stattfinden, werden die Nachkomm:innen meist primär als eine Art Ersatz für die verstorbenen Überlebenden angesprochen[2].
Der Projektrahmen
Zwischen 2017 und 2021 habe ich Interviews mit Menschen geführt, deren Eltern polnische (nicht-jüdische) politische Gefangene in verschiedenen deutschen Konzentrationslagern während des Krieges waren. In der Zwischenzeit, im Jahr 2020, habe ich einen Teil davon in einem Buch mit dem Titel Pogłosy[3] bearbeitet und veröffentlicht. Anschließend führte ich weitere Interviews mit einigen der Protagonist:innen des Buches[4]. Insgesamt führte ich 34 Interviews mit Männern und Frauen, die in Polen und im Ausland leben, aus verschiedenen Schichten stammen, unterschiedliche religiöse und politische Überzeugungen haben und sich in Gedenkorganisationen engagieren.
Mein Ziel war es, zu untersuchen, wie die Nachkomm:innen ihre eigene Biografie im Zusammenhang mit den Kriegserlebnissen ihrer Eltern wahrnehmen. Ein weiterer wichtiger Faktor, den ich erkannte, war die Erinnerungspolitik in Polen (die Art und Weise, wie Politiker:innen die öffentliche Erinnerung durch die Finanzierung von Bildung und Kultur, die Schaffung von Gesetzen und Entschädigungen sowie die Förderung von Ideen gestalten). Sowohl die sozialistischen Regierungen vor 1989 als auch die konservativ-liberalen Regierungen danach erkannten das polnische Martyrium in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern als wichtigen Bestandteil der öffentlichen Erinnerung an. Manchmal zeigten sich die Splitter ihrer Strategien auch in den Erzählungen meiner Interviewpartner:innen – vor allem bei denjenigen, die in Polen leben.
Die Geschichten
Die Fassade der Geschichte kann jedoch durchbrochen werden, wenn sie von konkreten Menschen mit konkreten Namen erzählt wird. Bevor wir uns der Perspektive der Nachkomm:innen zuwenden, wollen wir kurz bei den Worten der Überlebenden von Ravensbrück, Helena Hegier-Rafalska, verweilen, die im Lager pseudomedizinischen Experimenten ausgesetzt war. „Nach dem Krieg habe ich die Deutschen nicht gehasst. Sie taten mir leid, weil sie mir den Glauben an die Menschheit genommen hatten. Dass meine Träume mit Füßen getreten und zerstört wurden. Ich liebte meinen Sohn sehr und zitterte um ihn, und gleichzeitig konnte ich kein Lächeln hervorbringen. Ich war so verschlossen für ihn. Er war stärker als ich. Ich war wie aus Holz – ich sah ihn stundenlang an und weinte…“[5] – erinnerte sie sich Jahre später.
Aber die Last des generationenübergreifenden Traumas hat noch eine weitere Dimension. Jemand, der es in sich trägt, erlebt die Auswirkungen des Leidens seiner Eltern, ohne direkten Zugang zu dessen Ursache zu haben. Eine meiner Gesprächspartner:innen sagte: „Ich habe nicht akzeptiert, dass meine Mutter ihre Peiniger nicht gehasst hat. Ich kann das nicht verstehen, obwohl ich katholisch bin und weiß, dass ich vergeben sollte, wie sie es getan hat. Ich kann es nicht.“[6] Eine zutiefst emotionale Haltung kann sich mit einer begrenzten Fähigkeit vermischen, die eigenen Überzeugungen zu revidieren. Die zweite Generation hat nur Zugang zu einer bestimmten Version der Vergangenheit, die sich mit der Version (oder sogar einem Mythos) der Elternfigur überschneidet, sowie zu den persönlichen Erfahrungen des Aufwachsens in einer so belasteten Familie. Die Kinder der Häftlinge schildern nicht nur die Lagererfahrung ihrer Eltern, sondern auch das Leiden ihrer Mutter und ihres Vaters – manchmal als kalte oder furchteinflößende Person, manchmal als geliebte, idealisierte Person. Deshalb enthält die Postmemory ein mythenbildendes Element, das ganze Gemeinschaften betreffen kann, nicht nur die direkten Nachkomm:innen der Opfer.
Die deutsche Anthropologin Aleida Assman hat die israelische Geschichtserziehung einmal als „kulturelle Mnemotechnik des Schmerzes“[7] bezeichnet – in der posttraumatischen Kultur soll die Wunde nicht heilen. Einige meiner Gesprächspartner:innen, vor allem diejenigen, die sich mit Erinnerungsarbeit befassen, erwähnten die israelische Erinnerungspolitik mit allgemeiner Bewunderung als ein gutes, ja sogar beneidenswertes Beispiel. Für einige Beobachter:innen ist es schwierig, die immer noch vorhandene Tendenz (sowohl bei den Häftlingen als auch bei den Aktivist:innen der Erinnerungsarbeit) zu verstehen, eine spezifisch „polnische“ und nicht eine „universelle“ Lagererfahrung zu beschreiben oder zu gedenken. Dieses Phänomen sollte im geopolitischen Kontext des Ostblocks betrachtet werden. Verschiedene Überlebende waren jahrelang aus dem westlichen Kriegsdiskurs ausgeschlossen worden. Darüber hinaus waren die Polen nicht in der Lage, einen eingängigen, prägnanten Begriff für die komplizierten Erfahrungen von Zehntausenden von Menschen zu entwickeln. Die polnische Anthropologin Agnieszka Dauksza, die die polnischen Häftlinge von Auschwitz interviewte, beschrieb die Situation treffend als „polnische Erfahrung ohne Namen“[8]. Das Fehlen einer starken Symbolik verstärkte das Gefühl des Bedauerns, des Unverständnisses und der unzureichenden Aufmerksamkeit für die Erfahrung – diese Gefühle scheinen von einigen der Nachkomm:innen übernommen zu werden, insbesondere wenn es um die antideutschen Gefühle geht.
Aber auch die zweite Generation legt Zeugnis von ihrem eigenen Leid ab. Eine meiner Gesprächspartner:innen erklärte, dass sie einem Interview zustimmte, weil sie sich in die Gruppe der Opfer der Lager einreihen wollte. Ihre Mutter beschloss, nachdem sie mit den „weißen Bussen“ von Ravensbrück nach Schweden evakuiert worden war, nicht nach Polen zurückzukehren und ließ ihre Familie im Stich. Ihr Vater, ein Häftling von Auschwitz und Flossenbürg, misshandelte meine Interviewpartnerin und ihre Schwester psychisch und physisch[9]. Ein anderes Kind von zwei Häftlingen, ebenfalls Überlebende von Ravensbrück und Auschwitz, erinnerte sich: „Ich habe meine ganze Kindheit lang im Schatten dieser Lagergeschichten gelebt. Es ist die Düsternis, die zu Hause herrschte, diese Unfähigkeit, miteinander auszukommen… Sie waren beide mit dem KZ-Syndrom behaftet. Alles in allem ist es schwer zu sagen, was ihre wirkliche Persönlichkeit war und was das Ergebnis ihrer Erfahrungen war (…) Meine Mutter hatte nicht die Geduld, mich zu erziehen – ich war kein einfaches Kind, ich hatte meine eigene Meinung. Sie schlug mich mit der Hand, und wenn es etwas Schlimmeres gab, sagte sie es meinem Vater – er nahm den Gürtel und schlug mich (…) Meine Mutter war körperlich und geistig erschöpft. Ungeduldig. Nervös. Es war unmöglich, mit ihr zu streiten – es gab sofort einen scharfen Konflikt. Ich glaube, es war so eine erlernte Unfähigkeit nach dem Lager, wo sie überhaupt keinen Einfluss auf das Geschehen hatte.“[10] Solche dramatischen Stimmen der zweiten Generation lassen die monumentale und martyrologische Erzählung über den Krieg zerbrechen. Die Opfer des Krieges wurden gewissermaßen zu Eltern für andere Opfer.

© Iwona Makowska/Oral History Archive of the History Meeting House
In den Familien meiner Gesprächspartner:innen wurde kaum offen über die Kriegstraumata gesprochen. Viele von ihnen erinnerten sich an die Treffen ihrer Eltern mit ihren Lagerfreund:innen, aber alles, was sie als Kinder hörten, waren Geschichten voller schwarzem Humor oder Heroismus (z. B. wie es den Menschen gelang, im Lager ein religiöses, patriotisches oder künstlerisches Leben zu führen). Die Überlebenden erzählten selten von den schmerzlichen Erfahrungen der Angst, des Hungers oder der Einsamkeit. Die Darstellung des Lagers in den Mauern des Schweigens oder einer schematischen Erzählung vergrößerte nur die Distanz zwischen den Generationen. Das emotional unzugängliche Elternteil blieb ein Rätsel. Eine der Interviewpartner:innen, Bogna, sagte mir einmal: „Wir haben gesehen, dass meine Mutter nicht darüber reden wollte. Wir haben es gespürt. Wenn sie etwas erwähnte, dann meist mit einer solchen Distanz, ‚man‘ und nicht ‚ich‘: dass ‚man Kohlrüben aß‘ und nicht ‚ich aß Kohlrüben‘. Wir haben das sehr wohl gespürt und haben sie nicht danach gefragt.“[11]
Eine solche Distanz zwischen den Generationen kann sich auf die Kinder in vielerlei Hinsicht auswirken: Schwierigkeiten beim Aufbau enger Beziehungen im Erwachsenenalter, Umkehrung der Rollen und Übernahme der elterlichen Fürsorge oder unbewusster Verzicht auf ein eigenes befriedigendes Leben – wie im Geiste der Loyalität gegenüber einem Elternteil, der so viel gelitten hat. Eine meiner Interviewpartner:innen hat mir Folgendes erzählt: „Die Erlebnisse meiner Mutter in Ravensbrück haben mich so geprägt, dass ich mich nicht von ihr losreißen konnte. Es war für mich unvorstellbar, dass ich meine Mutter verlassen könnte. Es schien mir, dass ich in jedem Moment bei ihr sein musste – auf Kosten meines Privatlebens.“[12]
Fazit
Die Erfahrungen der Nachkomm:innen können durchaus als universelle Erzählungen über das Erbe des Krieges gelesen werden, das ganze Familien über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Ich bin jedoch der Meinung, dass wir zunächst die verschiedenen Kontexte der spezifischen Gruppen von Überlebenden und ihren Familien verstehen sollten, um eine allgemeine Geschichte sinnvoll aufzubauen.
Während meiner Recherchen traf ich sowohl auf engagierte Aktivist:innen, die die Geschichte ihrer Eltern erzählen wollten, als auch auf solche, die bei der bloßen Erwähnung des Themas zu zittern schienen und sich von der Vergangenheit distanzieren wollten. Ich habe gelernt, dass nicht jede:r Nachkomm:in bereit ist, die Rolle des Zeugen oder der Zeugin zu übernehmen, und dass es dafür verschiedene Gründe geben kann. Parallel dazu bestätigten einige Aktivist:innen, dass sie ihre Familienerfahrung nur durch die Linse meiner Forschung als im Allgemeinen liebevoll und bereichernd empfanden. Deshalb erklärten sie, dass sie Empathie für diejenigen entwickelt haben, die sich nicht engagieren wollen – seien es Fremde oder ihre älteren Geschwister. Aus heutiger Sicht verstehe ich die Erinnerung an den Krieg und das Überleben der Eltern als ein Reservoir, aus dem die Nachkomm:innen je nach ihren eigenen Persönlichkeitsmerkmalen, Interessen und persönlichen Lebensgeschichten verschiedene Bedeutungen ableiten.
Die Erinnerungspolitik instrumentalisiert oft die Wahrheit individueller Erfahrungen und verwandelt sie in vereinfachte, allgegenwärtige Erzählungen. Durch sorgfältige Recherche können wir die tatsächliche Komplexität des Themas vermitteln und die von der Politik geschürten Spaltungen überwinden.
[1] Zu den bemerkenswerten Ausnahmen gehören das Projekt des POLIN-Museums über die Nachkomm:innen des polnischen Judentums und das Projekt des Museums des Warschauer Aufstands über die Nachkomm:innen der Überlebenden des Warschauer Aufstandes von 1944.
[2] Meine Behauptung stützt sich auf meine Recherchen in der Sammlung mündlicher Überlieferungen des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau, den Austausch mit Mitarbeiter:innen des Staatlichen Museums in Majdanek und die Analyse ihrer Website. In meinem Artikel (auf Polnisch veröffentlicht) gehe ich näher darauf ein: M. Buko, Elzbieta Kuta, „Teraz to wszystko mi się poukładało w jedną, logiczną całość“ Wrocław Oral History Yearbook“, 11 2021, 116-159. https://doi.org/10.26774/wrhm.302
[3] Dieses Wort hat im Polnischen eine doppelte Bedeutung. Ins Deutsche übersetzt hieße es sowohl Nachhallen als auch Nach-Stimme, ins Englische: reverberations, sowie post-voices. M. Buko, Pogłosy. Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2020. https://ksiegarnia.dsh.waw.pl/pl/p/Maria-Buko-Poglosy.-Dzieci-wiezniow-niemieckich-obozow-koncentracyjnych/334.
[4] Der oben genannte Artikel enthält eine vergleichende Analyse solcher späteren Interviews mit einer Person, die in polnischer Sprache vorliegen. M. Buko, Elżbieta Kuta…
[5] Interview mit Helena Hegier-Rafalska, geführt von Katarzyna Madoń-Mitzner im Jahr 2006, Oral History Archive des Hauses der Geschichte und des Karta-Zentrums (OHA).
[6] Interview mit Elżbieta Kuta, geführt von Maria Buko im Jahr 2018, verfügbar bei der OHA.
[7] A. Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 1999, S. 190.
[8] A. Dauksza, “Doświadczenie bez nazwy. „Oświęcim” ≠ Auschwitz”, Teksty Drugie [Online], 6 | 2016, Online seit 15. November 2016, Zugriff am 23. Oktober 2022. URL: http://journals.openedition.org/td/1656
[9] Ein anonymes Interview in der Sammlung der Autorin
[10] Ein anonymes Interview in der Sammlung der Autorin
[11] Interview mit Bogna Neumann, geführt von Maria Buko im Jahr 2018, erhältlich bei der OHA
[12] Interview mit Elżbieta Kuta, geführt von Maria Buko im Jahr 2018, verfügbar bei der OHA